NACHLESE II
aus Zeitungen und Zeitschriften
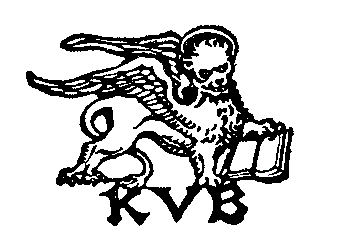
BERN
ist der geistliche Name von
Joseph Anton Schneiderfranken
© by Kobersche Verlagsbuchhandlung AG
Bern
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die der Übersetzung
in fremde Sprachen und der Verbreitung in Rundfunk, Fernsehen
und auf Tonträgern jeder Art, auch auszugsweise
ISBN 3-85767-101-7
.Bereits im Vorwort des ersten Bandes der neu
aufgelegten «Nachlese» konnten wir der Freude
Ausdruck geben, dass es möglich war, die Samm‐
lung von Texten von Bô Yin Râ stark erweitert in
zwei Bänden herauszugeben. Entspricht der erste
Band mit Ausnahme von einigen Erweiterungen
mehr oder weniger dem 1953 erschienenen
Buch, so enthält dieser zweite Band bisher nicht
oder kaum bekannte Artikel von Bô Yin Râ aus
den 20er und 30er Jahren, darunter einige Be‐
trachtungen über Kunst, die zwischen 1913 und
1920 in verschiedenen Tageszeitungen erschie‐
nen und von der Familie des Autors freundlicher‐
weise zur Verfügung gestellt wurden.
.Bô Yin Râ hat sich aber nicht nur über das ihm
eigene Gebiet der Kunst geäussert; er hat ‒ wie er
in einem seiner Aufsätze selbst schreibt ‒ auch
Themen aufgegriffen, «die der Tag nahegelegt
hatte», wenn er sich dadurch für den Leser in be‐
stimmten Fragen mehr Klarheit versprach. Dazu
gehören mehrere Abhandlungen sowie einige
aufgelegten «Nachlese» konnten wir der Freude
Ausdruck geben, dass es möglich war, die Samm‐
lung von Texten von Bô Yin Râ stark erweitert in
zwei Bänden herauszugeben. Entspricht der erste
Band mit Ausnahme von einigen Erweiterungen
mehr oder weniger dem 1953 erschienenen
Buch, so enthält dieser zweite Band bisher nicht
oder kaum bekannte Artikel von Bô Yin Râ aus
den 20er und 30er Jahren, darunter einige Be‐
trachtungen über Kunst, die zwischen 1913 und
1920 in verschiedenen Tageszeitungen erschie‐
nen und von der Familie des Autors freundlicher‐
weise zur Verfügung gestellt wurden.
.Bô Yin Râ hat sich aber nicht nur über das ihm
eigene Gebiet der Kunst geäussert; er hat ‒ wie er
in einem seiner Aufsätze selbst schreibt ‒ auch
Themen aufgegriffen, «die der Tag nahegelegt
hatte», wenn er sich dadurch für den Leser in be‐
stimmten Fragen mehr Klarheit versprach. Dazu
gehören mehrere Abhandlungen sowie einige
Buchbesprechungen, die Bô Yin Râ für den ihm
freundschaftlich verbundenen Inhaber des Ri‐
chard Hummel Verlags, Leipzig, verfasst hat. Für
den heutigen Leser, der sich die damalige Zeit
vergegenwärtigt, kann es wertvoll sein, sich ein
Bild davon zu machen, wie Bô Yin Râ stets leh‐
rend und hilfreich bestrebt war, einerseits das Po‐
sitive hervorzuheben, anderseits aber auch gele‐
gentliche Fehlinterpretationen mit Nachdruck
richtigzustellen.
.Die Anordnung der Texte ergab sich von selbst;
nach Möglichkeit wurde die chronologische Rei‐
henfolge bevorzugt.
.Leider sind die besprochenen Bücher im Buch‐
handel nicht mehr erhältlich. Der Verlag ist somit
nicht in der Lage, Bezugsquellen zu nennen.
.Bern.1990 Der.Verlag
freundschaftlich verbundenen Inhaber des Ri‐
chard Hummel Verlags, Leipzig, verfasst hat. Für
den heutigen Leser, der sich die damalige Zeit
vergegenwärtigt, kann es wertvoll sein, sich ein
Bild davon zu machen, wie Bô Yin Râ stets leh‐
rend und hilfreich bestrebt war, einerseits das Po‐
sitive hervorzuheben, anderseits aber auch gele‐
gentliche Fehlinterpretationen mit Nachdruck
richtigzustellen.
.Die Anordnung der Texte ergab sich von selbst;
nach Möglichkeit wurde die chronologische Rei‐
henfolge bevorzugt.
.Leider sind die besprochenen Bücher im Buch‐
handel nicht mehr erhältlich. Der Verlag ist somit
nicht in der Lage, Bezugsquellen zu nennen.
Außer «Die Technik der Wandgemälde von Tiryns» sind 00
alle Artikel in den Jahren 1919 und 1920 in verschiedenen 00
Görlitzer Zeitungen, besonders in den «Görlitzer Nach‐ 00
richten», erschienen.
alle Artikel in den Jahren 1919 und 1920 in verschiedenen 00
Görlitzer Zeitungen, besonders in den «Görlitzer Nach‐ 00
richten», erschienen.
DIE Malereien, deren Fragmente in Tiryns
gefunden wurden, betrachtet man kurzweg
als Fresken; aus maltechnischen Gründen dürfte
aber eine Modifizierung dieser Ansicht geboten
sein. Durch die Freundlichkeit Prof. Karos wurde
mir eine Untersuchung der Maltechnik dieser
Funde nahegelegt, und ich gebe nun hier die
Resultate.
.Man muß vor allem unterscheiden zwischen
der Technik der Gemälde des älteren und jener
des jüngeren Palastes.
.Die Fragmente vom älteren Palast zeigen einen
Farben-Auftrag, dessen Konsistenz unbedingt für
ein Bindemittel spricht, das der Farbe selbst beige‐
mengt war, während bekanntlich beim Fresko der
Kalk des Wandbewurfs die Farbe bindet, die, ohne
mit einem Bindemittel versehen zu sein, auf die feuchte
Wand aufgetragen wird.
gefunden wurden, betrachtet man kurzweg
als Fresken; aus maltechnischen Gründen dürfte
aber eine Modifizierung dieser Ansicht geboten
sein. Durch die Freundlichkeit Prof. Karos wurde
mir eine Untersuchung der Maltechnik dieser
Funde nahegelegt, und ich gebe nun hier die
Resultate.
der Technik der Gemälde des älteren und jener
des jüngeren Palastes.
Farben-Auftrag, dessen Konsistenz unbedingt für
ein Bindemittel spricht, das der Farbe selbst beige‐
mengt war, während bekanntlich beim Fresko der
Kalk des Wandbewurfs die Farbe bindet, die, ohne
mit einem Bindemittel versehen zu sein, auf die feuchte
Wand aufgetragen wird.
.Die Farbe liegt beim echten Fresko in der kla‐
ren Schicht kohlensauren Kalks, die sich an der
Luft bildet, wie in einen spröden, glasigen, dün‐
nen Firnis eingebettet und zeigt selbst nach star‐
ker Verwitterung noch etwas von der ursprüngli‐
chen Transparenz.
.Die Farbe der Gemälde des älteren Palastes da‐
gegen ist in pastoser Schichtung aufgetragen. Oft lie‐
gen mehrere Schichten übereinander, wie bei
dem Fragment eines Mannes mit Speer (Tiryns II
Taf.14) sehr schön zu sehen ist. Auf dem blauen
Grund, der hier die ganze Kalkfläche bedeckt,
sitzt das Rot der Hand und des Gesichtes, und auf
letzterem sitzt, sehr pastos, das Gelb des Bartes.
.Um solche dicke Schichten sicher zu binden,
reicht die Bindekraft des an der Oberfläche er‐
scheinenden wässerigen Kalks nicht aus. Die
ganze Konsistenz der Farbe ist die einer dicken
Leim- oder Temperafarbschicht, doch können
diese organischen Bindemittel nach der chemi‐
schen Untersuchung Mr. Heatons keinesfalls vor‐
liegen. Mir ist nur ein Bindemittel bekannt, das
hier enthalten sein könnte, und dessen Konsi‐
stenz die Farbe zeigt. Es ist die sogenannte Kalk‐
milch, d.i. gelöschter Kalk, der in einer größeren
Wassermenge verrührt wird.
ren Schicht kohlensauren Kalks, die sich an der
Luft bildet, wie in einen spröden, glasigen, dün‐
nen Firnis eingebettet und zeigt selbst nach star‐
ker Verwitterung noch etwas von der ursprüngli‐
chen Transparenz.
gegen ist in pastoser Schichtung aufgetragen. Oft lie‐
gen mehrere Schichten übereinander, wie bei
dem Fragment eines Mannes mit Speer (Tiryns II
Taf.14) sehr schön zu sehen ist. Auf dem blauen
Grund, der hier die ganze Kalkfläche bedeckt,
sitzt das Rot der Hand und des Gesichtes, und auf
letzterem sitzt, sehr pastos, das Gelb des Bartes.
reicht die Bindekraft des an der Oberfläche er‐
scheinenden wässerigen Kalks nicht aus. Die
ganze Konsistenz der Farbe ist die einer dicken
Leim- oder Temperafarbschicht, doch können
diese organischen Bindemittel nach der chemi‐
schen Untersuchung Mr. Heatons keinesfalls vor‐
liegen. Mir ist nur ein Bindemittel bekannt, das
hier enthalten sein könnte, und dessen Konsi‐
stenz die Farbe zeigt. Es ist die sogenannte Kalk‐
milch, d.i. gelöschter Kalk, der in einer größeren
Wassermenge verrührt wird.
.Mit dieser Flüssigkeit wird die Malfarbe ver‐
setzt. Man kann dann auf feuchten oder trockenen
Grund malen und die Farbe wird hart an der
Luft. Mitunter wird sie heute noch im Handwerk
verwendet, oft auch mit Zusätzen von Käse‐
Quark, als Kasein-Kalkfarbe. Ob sich ein solcher
Zusatz hier annehmen läßt, weiß ich nicht. Ich
möchte für reine Kalkfarbe eintreten. Eine Bestäti‐
gung sehe ich in Mr. Heatons mikroskopischer
Untersuchung (Tiryns II 211 ff.). Mr. Heaton er‐
kannte dabei kleine Kalkteile zwischen den Farb‐
körperchen, für die man, bei der bisherigen Vor‐
aussetzung reiner Fresko Technik, nur die im‐
merhin unbefriedigende Erklärung finden
konnte, sie seien durch den Pinsel zufällig vom
feuchten Grunde gelöst.
.Ganz anders liegt die Sache bei den Stücken des
jüngeren Palastes. Hier wurde zuerst die ganze
Fläche «al fresco» dünn bemalt, und auf dieser,
die alle Charakteristiken der Freskomalerei auf‐
weist, in der alten Kalkfarben Technik pastos wei‐
ter gearbeitet. Sehr schön sieht man an dem gro‐
ßen Fragment mit dem Kopf einer Frau (Tiryns II
Taf. IX) den Gegensatz der dünnen, mit dem gla‐
sig spröden Kalkgrund sozusagen verwachsenen
Unterlage, die zweifellos in Fresko gemalt ist, zu
der nach dem Trocknen des Grundes aufgesetz‐
setzt. Man kann dann auf feuchten oder trockenen
Grund malen und die Farbe wird hart an der
Luft. Mitunter wird sie heute noch im Handwerk
verwendet, oft auch mit Zusätzen von Käse‐
Quark, als Kasein-Kalkfarbe. Ob sich ein solcher
Zusatz hier annehmen läßt, weiß ich nicht. Ich
möchte für reine Kalkfarbe eintreten. Eine Bestäti‐
gung sehe ich in Mr. Heatons mikroskopischer
Untersuchung (Tiryns II 211 ff.). Mr. Heaton er‐
kannte dabei kleine Kalkteile zwischen den Farb‐
körperchen, für die man, bei der bisherigen Vor‐
aussetzung reiner Fresko Technik, nur die im‐
merhin unbefriedigende Erklärung finden
konnte, sie seien durch den Pinsel zufällig vom
feuchten Grunde gelöst.
jüngeren Palastes. Hier wurde zuerst die ganze
Fläche «al fresco» dünn bemalt, und auf dieser,
die alle Charakteristiken der Freskomalerei auf‐
weist, in der alten Kalkfarben Technik pastos wei‐
ter gearbeitet. Sehr schön sieht man an dem gro‐
ßen Fragment mit dem Kopf einer Frau (Tiryns II
Taf. IX) den Gegensatz der dünnen, mit dem gla‐
sig spröden Kalkgrund sozusagen verwachsenen
Unterlage, die zweifellos in Fresko gemalt ist, zu
der nach dem Trocknen des Grundes aufgesetz‐
ten, pastosen und stumpfen Kalkfarbe. Es scheint
fast, als stünde man an der Wiege der Fresko‐
Malerei. Gefärbte Kalktünche war bekannt. Es lag
dann nahe, mit verschieden gefärbten Tünchen
(Kalkfarben) auf die Wände zu malen. Das Ergeb‐
nis hätten wir beim älteren Palast. Ein Zufall
mochte den Malern gezeigt haben, daß die Farbe
auch ohne Kalkmilchzusatz hält, wenn sie auf den
noch feuchten Kalkputz aufgetragen wird. Bald
mußten sie sehen, daß man auf diese Art flüssiger,
flotter und leichter arbeiten kann, ja daß die
Technik dies geradezu verlangt. So bemalten sie
wohl die frisch beworfene ganze Wand ziemlich
flüchtig und leicht, solange es die Feuchtigkeit des
Kalkes zuließ, ohne vorerst daran zu denken, daß
man den Kalkgrund stückweise aneinandersetzen
könnte, um das Gemälde «al fresco» fertig zu ma‐
len, wie das in der Renaissance geschah. Dies
würde auch das Fehlen der für Fresko charakteri‐
stischen Fugen erklären.
.Al fresco malten sie wohl alles, was sich mög‐
lichst schnell auf der ganzen Malfläche machen
ließ. Die großen Farbmassen füllten sie dann mit
Kalkfarbe, mit der sie auch das Ganze vollende‐
ten, ähnlich wie man heute noch ein trockenes
Fresko mit Temperafarbe retouchiert. Die Maler
von Tiryns dürften jedoch das Fertigstellen in
fast, als stünde man an der Wiege der Fresko‐
Malerei. Gefärbte Kalktünche war bekannt. Es lag
dann nahe, mit verschieden gefärbten Tünchen
(Kalkfarben) auf die Wände zu malen. Das Ergeb‐
nis hätten wir beim älteren Palast. Ein Zufall
mochte den Malern gezeigt haben, daß die Farbe
auch ohne Kalkmilchzusatz hält, wenn sie auf den
noch feuchten Kalkputz aufgetragen wird. Bald
mußten sie sehen, daß man auf diese Art flüssiger,
flotter und leichter arbeiten kann, ja daß die
Technik dies geradezu verlangt. So bemalten sie
wohl die frisch beworfene ganze Wand ziemlich
flüchtig und leicht, solange es die Feuchtigkeit des
Kalkes zuließ, ohne vorerst daran zu denken, daß
man den Kalkgrund stückweise aneinandersetzen
könnte, um das Gemälde «al fresco» fertig zu ma‐
len, wie das in der Renaissance geschah. Dies
würde auch das Fehlen der für Fresko charakteri‐
stischen Fugen erklären.
lichst schnell auf der ganzen Malfläche machen
ließ. Die großen Farbmassen füllten sie dann mit
Kalkfarbe, mit der sie auch das Ganze vollende‐
ten, ähnlich wie man heute noch ein trockenes
Fresko mit Temperafarbe retouchiert. Die Maler
von Tiryns dürften jedoch das Fertigstellen in
Kalkfarben keineswegs als Retouche betrachtet
haben, denn beide Techniken haben an der ferti‐
gen Malerei gleichen Anteil.
.Den Vertiefungen im Malgrund darf man, mei‐
ner Meinung nach, keine zu große Wichtigkeit bei‐
messen. Ich halte die Vertiefungen der Gewand‐
teile für Schabungen, die durch Korrekturen nötig
wurden. Auf solchen ausgeschabten Stellen moch‐
ten die Farben nachher sehr roh wirken, weshalb
man sie nach dem Trocknen zu glätten versuchte.
Die Schnüre, bei den Netzen der Jagd, werden
wohl in den noch weichen Grund eingedrückt sein,
und zwar bei der summarischen Aufzeichnung des
Ganzen. Die geraden Linien des Architektur-Frag‐
ments scheinen mir dagegen in den trockenen
Grund geritzt. Ich schließe das aus der Beschaffen‐
heit der Ränder. In beiden Fällen liegt die Farbe
flüssig eingelaufen in den kleinen Kanälen. Wäre
sie mit eingedrückt worden, nachdem die Malerei
beendigt war, so müßte dies unbedingt an der
Oberfläche des Farbflusses zu erkennen sein.
.Sowohl beim älteren wie beim jüngeren Palast
ging die Arbeit sichtlich schnell von statten, und
wenn die Maler des alten Palastes den frischen
Kalkgrund auch noch nicht zur Bindung der
Farbe auszunützen verstanden, so mußten sie
doch keineswegs warten, bis er trocken war.
haben, denn beide Techniken haben an der ferti‐
gen Malerei gleichen Anteil.
ner Meinung nach, keine zu große Wichtigkeit bei‐
messen. Ich halte die Vertiefungen der Gewand‐
teile für Schabungen, die durch Korrekturen nötig
wurden. Auf solchen ausgeschabten Stellen moch‐
ten die Farben nachher sehr roh wirken, weshalb
man sie nach dem Trocknen zu glätten versuchte.
Die Schnüre, bei den Netzen der Jagd, werden
wohl in den noch weichen Grund eingedrückt sein,
und zwar bei der summarischen Aufzeichnung des
Ganzen. Die geraden Linien des Architektur-Frag‐
ments scheinen mir dagegen in den trockenen
Grund geritzt. Ich schließe das aus der Beschaffen‐
heit der Ränder. In beiden Fällen liegt die Farbe
flüssig eingelaufen in den kleinen Kanälen. Wäre
sie mit eingedrückt worden, nachdem die Malerei
beendigt war, so müßte dies unbedingt an der
Oberfläche des Farbflusses zu erkennen sein.
ging die Arbeit sichtlich schnell von statten, und
wenn die Maler des alten Palastes den frischen
Kalkgrund auch noch nicht zur Bindung der
Farbe auszunützen verstanden, so mußten sie
doch keineswegs warten, bis er trocken war.
.Ob die Verschiedenheit der Stücke des älteren
und jüngeren Palastes, infolge der durch die
Fundumstände sicheren Datierung, ein geeigne‐
tes Datierungsmerkmal auch für andere Funde
abgeben kann, entzieht sich meiner Beurteilung.
und jüngeren Palastes, infolge der durch die
Fundumstände sicheren Datierung, ein geeigne‐
tes Datierungsmerkmal auch für andere Funde
abgeben kann, entzieht sich meiner Beurteilung.
.Athen, Februar 1913
ES ist eine höchst erfreuliche Tatsache, und
mir persönlich in Wien zum ersten Male auf‐
gefallen, daß immer weitere Kreise der Arbeiter‐
schaft für die bildenden Künste, also Malerei und
Plastik, ein immer regeres Interesse zeigen.
.Der Ruf: «Die Kunst dem Volke!» ist zwar schon
längst gehört worden, aber man packte die Sache
am verkehrten Ende an. Man verlangte von den
Künstlern, sie sollten Werke schaffen, denen ähn‐
lich, die das Volk bereits gewohnt sei, weil man es
für selbstverständlich hielt, daß «das Volk» ‒ wo‐
mit man zumeist nur einen Teil des Volkes, näm‐
lich die Arbeiterkreise meinte, ‒ gar kein Inter‐
esse für jene Werke der Kunst haben könne, die
geistige Mitarbeit voraussetzen, will man ihre höch‐
sten Werte erfassen und sie als eine Lebensberei‐
cherung genießen. Man hat sich, wie ich kaum
einem intelligenten Arbeiter zu sagen brauche,
mächtig getäuscht, denn wo man auch bis jetzt den
Versuch machte, der Arbeiterschaft einen Ein‐
mir persönlich in Wien zum ersten Male auf‐
gefallen, daß immer weitere Kreise der Arbeiter‐
schaft für die bildenden Künste, also Malerei und
Plastik, ein immer regeres Interesse zeigen.
längst gehört worden, aber man packte die Sache
am verkehrten Ende an. Man verlangte von den
Künstlern, sie sollten Werke schaffen, denen ähn‐
lich, die das Volk bereits gewohnt sei, weil man es
für selbstverständlich hielt, daß «das Volk» ‒ wo‐
mit man zumeist nur einen Teil des Volkes, näm‐
lich die Arbeiterkreise meinte, ‒ gar kein Inter‐
esse für jene Werke der Kunst haben könne, die
geistige Mitarbeit voraussetzen, will man ihre höch‐
sten Werte erfassen und sie als eine Lebensberei‐
cherung genießen. Man hat sich, wie ich kaum
einem intelligenten Arbeiter zu sagen brauche,
mächtig getäuscht, denn wo man auch bis jetzt den
Versuch machte, der Arbeiterschaft einen Ein‐
blick in die Probleme der bildenden Kunst zu ver‐
mitteln, fand sich regstes Interesse, verstehendes
Mitgehen auf den Pfaden, die zur sogenannten
«Hohen Kunst» führen, die nichts anderes ist, als
ein Gestalten aus Werten, die tief in jedem mensch‐
lichen Geiste verborgen ruhen, und die zu heben
und sichtbar zu machen eben des wahren Künst‐
lers Beruf ist. ‒ Es gibt daneben allerdings auch
eine Art Darstellerei, die wohl «gekonnt» sein will,
aber trotzdem nichts mit wahrer Kunst zu tun hat.
Sie serviert der Menschheit immer wieder die
schon tausend- und abertausendmal abgewandel‐
ten Motive, bald ist es ein «schöner» Frauenkopf,
bald irgend eine Anekdotenmalerei, bald eine
süßliche Landschaft, und erfordert vom Be‐
schauer rein gar nichts an geistiger Mitarbeit. Es ist
begreiflich, daß der Mann der Arbeit an solchen
Werken, wie an besseren Spielereien, achtlos und
achtungslos vorübergeht, aber sein Interesse wird
sofort geweckt, wenn er sieht, daß auch das Schaf‐
fen des Künstlers sehr ernste Lebenswerte fördert,
die ihm Freude und Beglückung geben können,
auf die er verzichten müßte, wollte er am Kunst‐
schaffen seiner Zeit teilnahmslos vorübergehen.
.Warum sollte es auch verwunderlich sein, daß
der Arbeiter, und nicht etwa nur der selbst mit
Pinsel und Farbe Bescheid Wissende, sondern
mitteln, fand sich regstes Interesse, verstehendes
Mitgehen auf den Pfaden, die zur sogenannten
«Hohen Kunst» führen, die nichts anderes ist, als
ein Gestalten aus Werten, die tief in jedem mensch‐
lichen Geiste verborgen ruhen, und die zu heben
und sichtbar zu machen eben des wahren Künst‐
lers Beruf ist. ‒ Es gibt daneben allerdings auch
eine Art Darstellerei, die wohl «gekonnt» sein will,
aber trotzdem nichts mit wahrer Kunst zu tun hat.
Sie serviert der Menschheit immer wieder die
schon tausend- und abertausendmal abgewandel‐
ten Motive, bald ist es ein «schöner» Frauenkopf,
bald irgend eine Anekdotenmalerei, bald eine
süßliche Landschaft, und erfordert vom Be‐
schauer rein gar nichts an geistiger Mitarbeit. Es ist
begreiflich, daß der Mann der Arbeit an solchen
Werken, wie an besseren Spielereien, achtlos und
achtungslos vorübergeht, aber sein Interesse wird
sofort geweckt, wenn er sieht, daß auch das Schaf‐
fen des Künstlers sehr ernste Lebenswerte fördert,
die ihm Freude und Beglückung geben können,
auf die er verzichten müßte, wollte er am Kunst‐
schaffen seiner Zeit teilnahmslos vorübergehen.
der Arbeiter, und nicht etwa nur der selbst mit
Pinsel und Farbe Bescheid Wissende, sondern
auch der Mann am Schraubstock, an der Dreh‐
bank und an der Maschine, sich für die Probleme
wahrer Kunst lebhaft interessieren kann? Sein
Geistesleben braucht Nahrung und Arbeitsmate‐
rial für die verschiedensten Gehirnzentren. Zu‐
meist wird es ausgefüllt mit den Gedanken, die
seine Alltagsarbeit begleiten, mit Politik im Inter‐
esse seiner Lebensbedingungen, und vielleicht
noch mit populärwissenschaftlicher Lektüre. Das
reiche Gebiet der bildenden Kunst wurde nur sel‐
ten betreten und jene Gehirnpartien, die es sich
erobern könnten, lagen still, sind fast unbenutzt
und warten darauf, daß ihr Eigner sie in Ge‐
brauch nehme und sie ebenso entwickle, wie er
andere Gehirnzentren entwickelt hat. Der aller‐
erste Anfang mag eine gewisse Anstrengung ko‐
sten, aber bald treten bestimmte Beobachtungen
auf, die dem erstaunten Auge zeigen, daß die
Werke bildender Kunst keineswegs nur dem
Schmuckbedürfnis dienen, keineswegs überflüssige
Dinge für reiche Liebhaber sind, sondern: Spiegel
des menschlichen Empfindens einer Zeit, Bekenntnisse
der Seele einer Zeit, Dokumente des Fortschritts,
Predigten einer Religion, die zutiefst in einem je‐
den Menschenherzen lebt, und nicht zum wenig‐
sten in der Brust unter dem blauen Kittel, im Ge‐
dröhne und Gestampfe der Fabriken...
bank und an der Maschine, sich für die Probleme
wahrer Kunst lebhaft interessieren kann? Sein
Geistesleben braucht Nahrung und Arbeitsmate‐
rial für die verschiedensten Gehirnzentren. Zu‐
meist wird es ausgefüllt mit den Gedanken, die
seine Alltagsarbeit begleiten, mit Politik im Inter‐
esse seiner Lebensbedingungen, und vielleicht
noch mit populärwissenschaftlicher Lektüre. Das
reiche Gebiet der bildenden Kunst wurde nur sel‐
ten betreten und jene Gehirnpartien, die es sich
erobern könnten, lagen still, sind fast unbenutzt
und warten darauf, daß ihr Eigner sie in Ge‐
brauch nehme und sie ebenso entwickle, wie er
andere Gehirnzentren entwickelt hat. Der aller‐
erste Anfang mag eine gewisse Anstrengung ko‐
sten, aber bald treten bestimmte Beobachtungen
auf, die dem erstaunten Auge zeigen, daß die
Werke bildender Kunst keineswegs nur dem
Schmuckbedürfnis dienen, keineswegs überflüssige
Dinge für reiche Liebhaber sind, sondern: Spiegel
des menschlichen Empfindens einer Zeit, Bekenntnisse
der Seele einer Zeit, Dokumente des Fortschritts,
Predigten einer Religion, die zutiefst in einem je‐
den Menschenherzen lebt, und nicht zum wenig‐
sten in der Brust unter dem blauen Kittel, im Ge‐
dröhne und Gestampfe der Fabriken...
.Man suchte Kunst «ins Volk» zu bringen, indem
man billige Reproduktionen guter Kunstwerke,
billige Künstlergraphik herstellte, damit so der
unwürdige fade «Öldruck» ohne jeglichen Wert,
aus der guten Stube des Arbeiters verschwinde.
Das ist gut und löblich und bereits ein großer
Schritt nach vorwärts, aber man war noch viel zu
ängstlich und ist es noch, so daß man nur solche
Kunstwerke wählte, die zwar alle Ansprüche er‐
füllen, die an einen wertvollen Schmuck der
Wände zu stellen sind, aber dennoch herzlich we‐
nig von jener tieferen Kunstauffassung verraten,
die den Künstler zum Schaffen zwingt, als einen
Künder menschlicher Seelentiefen, einen Gestal‐
ter der Symbole reiner Menschlichkeit. ‒ ‒ Auch
darin wird die Zeit Wandel schaffen, wenn das Be‐
dürfnis sich zeigt. ‒ Aber wer, selbst wenn er Milli‐
ardär wäre, könnte sich jemals alle Kunstwerke
kaufen, die seine Seele befruchten können? Wer
könnte sie ständig auch nur alle um sich sehen,
und sei es auch nur in guten Reproduktionen?
Gewohnheit macht stumpf, verdirbt und ermü‐
det. ‒ Dagegen wird der Eindruck, den ein inten‐
siv sich einbohrender Beschauer vor vielen Jah‐
ren von einem Kunstwerk in irgend einer guten
Ausstellung erhielt, auch nach weiteren vielen
Jahren niemals schwinden. ‒
man billige Reproduktionen guter Kunstwerke,
billige Künstlergraphik herstellte, damit so der
unwürdige fade «Öldruck» ohne jeglichen Wert,
aus der guten Stube des Arbeiters verschwinde.
Das ist gut und löblich und bereits ein großer
Schritt nach vorwärts, aber man war noch viel zu
ängstlich und ist es noch, so daß man nur solche
Kunstwerke wählte, die zwar alle Ansprüche er‐
füllen, die an einen wertvollen Schmuck der
Wände zu stellen sind, aber dennoch herzlich we‐
nig von jener tieferen Kunstauffassung verraten,
die den Künstler zum Schaffen zwingt, als einen
Künder menschlicher Seelentiefen, einen Gestal‐
ter der Symbole reiner Menschlichkeit. ‒ ‒ Auch
darin wird die Zeit Wandel schaffen, wenn das Be‐
dürfnis sich zeigt. ‒ Aber wer, selbst wenn er Milli‐
ardär wäre, könnte sich jemals alle Kunstwerke
kaufen, die seine Seele befruchten können? Wer
könnte sie ständig auch nur alle um sich sehen,
und sei es auch nur in guten Reproduktionen?
Gewohnheit macht stumpf, verdirbt und ermü‐
det. ‒ Dagegen wird der Eindruck, den ein inten‐
siv sich einbohrender Beschauer vor vielen Jah‐
ren von einem Kunstwerk in irgend einer guten
Ausstellung erhielt, auch nach weiteren vielen
Jahren niemals schwinden. ‒
.Dieser Beschauer ist dann der wahre Besitzer
des Werkes, während es noch sehr fraglich sein
kann, ob es dem Künstler, der mit großen Auf‐
wendungen und seltenen Verkäufen zu rechnen
hat und darum gezwungen ist, scheinbar hohe
Preise anzusetzen, (von denen meist noch vieles
«abgehandelt» wird!) wirklich gelang, einen Käu‐
fer zu finden, der auch das Werk geistig zu «besit‐
zen» fähig ist. ‒ Man braucht keinen großen Geld‐
beutel zu haben, um ein Freund und empfinden‐
der Versteher der bildenden Kunst zu werden. Es
ist noch weniger nötig, dicke Bücher über Kunst
zu lesen, oder gar die Jahreszahlen der Kunstge‐
schichte auswendig zu wissen. Wer so anfängt,
zäumt den Gaul am Schwanze auf und hat nur alle
Aussicht, einer der vielen Halbwisser, der vielen
Schwätzer zu werden, die wirklichem Kunster‐
fühlen im Wege stehen, soviel sie auch mit ihren
zusammengelesenen Floskeln zu imponieren ver‐
suchen. Um sich das Lebensgebiet der Kunst zu
erobern, dazu bedarf es lediglich gesunder, se‐
hender Augen, eines tiefen und echten Lebensge‐
fühls, und des ehrlichen Willens, den Schöpfungs‐
prozeß eines Kunstwerkes in eigener Seele nach‐
erleben zu wollen, des Willens, die Sprache der
Formen und Farben verstehen zu lernen, die der
Künstler spricht, so wie man sich auch im ge‐
des Werkes, während es noch sehr fraglich sein
kann, ob es dem Künstler, der mit großen Auf‐
wendungen und seltenen Verkäufen zu rechnen
hat und darum gezwungen ist, scheinbar hohe
Preise anzusetzen, (von denen meist noch vieles
«abgehandelt» wird!) wirklich gelang, einen Käu‐
fer zu finden, der auch das Werk geistig zu «besit‐
zen» fähig ist. ‒ Man braucht keinen großen Geld‐
beutel zu haben, um ein Freund und empfinden‐
der Versteher der bildenden Kunst zu werden. Es
ist noch weniger nötig, dicke Bücher über Kunst
zu lesen, oder gar die Jahreszahlen der Kunstge‐
schichte auswendig zu wissen. Wer so anfängt,
zäumt den Gaul am Schwanze auf und hat nur alle
Aussicht, einer der vielen Halbwisser, der vielen
Schwätzer zu werden, die wirklichem Kunster‐
fühlen im Wege stehen, soviel sie auch mit ihren
zusammengelesenen Floskeln zu imponieren ver‐
suchen. Um sich das Lebensgebiet der Kunst zu
erobern, dazu bedarf es lediglich gesunder, se‐
hender Augen, eines tiefen und echten Lebensge‐
fühls, und des ehrlichen Willens, den Schöpfungs‐
prozeß eines Kunstwerkes in eigener Seele nach‐
erleben zu wollen, des Willens, die Sprache der
Formen und Farben verstehen zu lernen, die der
Künstler spricht, so wie man sich auch im ge‐
wöhnlichen Leben an die Ausdrucksweise eines
Menschen erst gewöhnen muß, wenn man ihn
nicht ständig mißverstehen will. ‒ ‒
Menschen erst gewöhnen muß, wenn man ihn
nicht ständig mißverstehen will. ‒ ‒
DAS OBERLAUSITZER
HEIMATMUSEUM
HEIMATMUSEUM
DIE «Ruhmeshalle» kennt in Görlitz jedes
Kind, auch wenn sie offiziell «Gedenkhalle»
heißt, aber daß die eigentliche «Ruhmeshalle»
nur der räumliche Mittelpunkt eines zwar nicht
sehr großen, aber reichen und hochinteressanten
Museums ist, dessen scheint man sich in Görlitz
und Umgebung immer noch nicht genügend zu
erinnern, soll es doch vorgekommen sein, daß ein
Fremder nach dem «Kaiser-Friedrich-Museum»
fragte und von einem Einheimischen die Antwort
bekam, ein solches gäbe es hier nicht. ‒
.Gewiß, die Besucherzahl ist in letzter Zeit im
Steigen begriffen und die reichen, besonders auf
die Geschichte der Oberlausitz bezüglichen
Schätze beginnen allmählich auch Fremde anzu‐
ziehen, die speziell zur Besichtigung des Muse‐
ums nach Görlitz kommen, oder deshalb hier ihre
Reise unterbrechen.
.Es hat aber trotzdem den Anschein, als ob man
sich in Görlitz selbst noch recht wenig darüber
Kind, auch wenn sie offiziell «Gedenkhalle»
heißt, aber daß die eigentliche «Ruhmeshalle»
nur der räumliche Mittelpunkt eines zwar nicht
sehr großen, aber reichen und hochinteressanten
Museums ist, dessen scheint man sich in Görlitz
und Umgebung immer noch nicht genügend zu
erinnern, soll es doch vorgekommen sein, daß ein
Fremder nach dem «Kaiser-Friedrich-Museum»
fragte und von einem Einheimischen die Antwort
bekam, ein solches gäbe es hier nicht. ‒
Steigen begriffen und die reichen, besonders auf
die Geschichte der Oberlausitz bezüglichen
Schätze beginnen allmählich auch Fremde anzu‐
ziehen, die speziell zur Besichtigung des Muse‐
ums nach Görlitz kommen, oder deshalb hier ihre
Reise unterbrechen.
sich in Görlitz selbst noch recht wenig darüber
klar wäre, welche Bedeutung das kleine Museum
für die Stadt hat.
.Vielleicht werden die fremden Besucher mit ih‐
rer wachsenden Anzahl darin eine Änderung be‐
wirken und den Einheimischen mit der Zeit zei‐
gen, daß der eigentliche Wert ihrer «Ruhmes‐
halle» denn doch weniger in der dekorativen Wir‐
kung des Gebäudes von außen, als in den Samm‐
lungen zu suchen ist, die dieser Kunsttempel über
dem anmutigen Neißeufer beherbergt. ‒
.Eine schier übermenschliche Arbeit hat der Di‐
rektor des Museums, Prof. Feyerabend, geleistet,
um diese Sammlungen aufzubringen und in wür‐
diger Weise aufzustellen. Das Museum ist eigent‐
lich sein eigenstes Werk, ein Lebenswerk von
nicht unbeträchtlicher Bedeutung.
.Freilich, ohne die Hilfe zahlreicher Gönner des
Museums wäre es ihm nicht möglich gewesen, die
von ihm kahl und leer übernommenen Museums‐
räume zu füllen, aber wer einigermaßen weiß, was
es heißt, ohne irgendeine museumstechnisch ge‐
schulte Hilfskraft, wie er sie längst hätte haben
müssen, ein solches Museum zusammenzubrin‐
gen, zu ordnen und zu leiten, und, was nicht zu‐
letzt genannt werden sollte, in lebendigem Kon‐
nex mit dem übrigen deutschen Museumswesen
für die Stadt hat.
rer wachsenden Anzahl darin eine Änderung be‐
wirken und den Einheimischen mit der Zeit zei‐
gen, daß der eigentliche Wert ihrer «Ruhmes‐
halle» denn doch weniger in der dekorativen Wir‐
kung des Gebäudes von außen, als in den Samm‐
lungen zu suchen ist, die dieser Kunsttempel über
dem anmutigen Neißeufer beherbergt. ‒
rektor des Museums, Prof. Feyerabend, geleistet,
um diese Sammlungen aufzubringen und in wür‐
diger Weise aufzustellen. Das Museum ist eigent‐
lich sein eigenstes Werk, ein Lebenswerk von
nicht unbeträchtlicher Bedeutung.
Museums wäre es ihm nicht möglich gewesen, die
von ihm kahl und leer übernommenen Museums‐
räume zu füllen, aber wer einigermaßen weiß, was
es heißt, ohne irgendeine museumstechnisch ge‐
schulte Hilfskraft, wie er sie längst hätte haben
müssen, ein solches Museum zusammenzubrin‐
gen, zu ordnen und zu leiten, und, was nicht zu‐
letzt genannt werden sollte, in lebendigem Kon‐
nex mit dem übrigen deutschen Museumswesen
zu erhalten, der kam nicht umhin, die Lebensar‐
beit Prof. Feyerabends im allerhöchsten Maße zu
bewundern.
.Er hat sich damit den wärmsten Dank der heu‐
tigen und kommender Generationen in Görlitz
verdient.
.Es wäre leicht, an einer ganzen Reihe von Bei‐
spielen zu zeigen, wie auch ein kleines, gutgeleite‐
tes Museum in einer kleinen oder mittleren Stadt,
den Ruf dieser Stadt in kultureller Hinsicht zu
verbreiten geeignet ist, wie es ihre Fremdenziffer
und damit ihren Wohlstand hebt und ihren Gel‐
tungsbereich erweitert. Daß auch das Görlitzer
Museum den Grundstock besitzt, um sich zu sol‐
cher Bedeutung für seine Heimatstadt und weit
darüber hinaus emporzuarbeiten, lehrt ein auf‐
merksamer Rundgang in seinen Räumen.
.Der Qualität nach am mäßigsten bedacht ist noch
seine kleine Gemäldegalerie, sehr zum Leidwesen
des Direktors, der auch hier mit Freuden nur das
Beste zeigen möchte. Die dem Laien so imponie‐
renden Riesenleinwanden mit den Ausklängen
der theatralischen und im eigentlich künstleri‐
schen Sinn so wenig ausgiebigen Piloty- und
Kaulbach-Zeit bedecken da nebst andern künst‐
lerisch belanglosen Repräsentationsbildern gan‐
beit Prof. Feyerabends im allerhöchsten Maße zu
bewundern.
tigen und kommender Generationen in Görlitz
verdient.
spielen zu zeigen, wie auch ein kleines, gutgeleite‐
tes Museum in einer kleinen oder mittleren Stadt,
den Ruf dieser Stadt in kultureller Hinsicht zu
verbreiten geeignet ist, wie es ihre Fremdenziffer
und damit ihren Wohlstand hebt und ihren Gel‐
tungsbereich erweitert. Daß auch das Görlitzer
Museum den Grundstock besitzt, um sich zu sol‐
cher Bedeutung für seine Heimatstadt und weit
darüber hinaus emporzuarbeiten, lehrt ein auf‐
merksamer Rundgang in seinen Räumen.
seine kleine Gemäldegalerie, sehr zum Leidwesen
des Direktors, der auch hier mit Freuden nur das
Beste zeigen möchte. Die dem Laien so imponie‐
renden Riesenleinwanden mit den Ausklängen
der theatralischen und im eigentlich künstleri‐
schen Sinn so wenig ausgiebigen Piloty- und
Kaulbach-Zeit bedecken da nebst andern künst‐
lerisch belanglosen Repräsentationsbildern gan‐
ze Wände und hindern die so sehr wünschens‐
werte, neuzeitlich mustergültige Verteilung der
zwar noch recht wenigen, aber immerhin vorhan‐
denen Werke von wirklichem Kunstwert.
.Besitzt doch die kleine Galerie neben einigen
andern nicht unbedeutenden Stücken tatsächlich
einen echten, wenn auch für das Gesamtschaffen
nicht so ganz instruktiven Böcklin, zwei Werke des
hochbedeutenden, in seiner Eigenart so beschei‐
denen Hans von Volkmann, eine zweite Fassung des
«Gestades der Vergessenheit» von Bracht, einen
sehr guten Schramm-Zittau, ein bedeutendes mo‐
numentales Werk von Lesset Ury, ein gutes Porträt
seines Töchterchens von Franz Stuck und eine An‐
zahl nicht unbedeutender Gemälde aus dem älte‐
ren Münchener Künstlerkreis. Immerhin genug,
um neben den hier nicht genannten bedeutende‐
ren Werken den Ausgangspunkt einer kleinen
guten Gemäldesammlung darzustellen.
.Wichtiger aber, und naturgemäß besser be‐
dacht, ist zurzeit noch die reichhaltige Sammlung
von Stichen, Zeichnungen und andern Kunstblät‐
tern, die sich auf die Geschichte von Görlitz, die
Geschichte der Oberlausitz beziehen.
.Vielleicht am vollständigsten ist dann die eben‐
falls nach den Interessen der Heimatgeschichte
werte, neuzeitlich mustergültige Verteilung der
zwar noch recht wenigen, aber immerhin vorhan‐
denen Werke von wirklichem Kunstwert.
andern nicht unbedeutenden Stücken tatsächlich
einen echten, wenn auch für das Gesamtschaffen
nicht so ganz instruktiven Böcklin, zwei Werke des
hochbedeutenden, in seiner Eigenart so beschei‐
denen Hans von Volkmann, eine zweite Fassung des
«Gestades der Vergessenheit» von Bracht, einen
sehr guten Schramm-Zittau, ein bedeutendes mo‐
numentales Werk von Lesset Ury, ein gutes Porträt
seines Töchterchens von Franz Stuck und eine An‐
zahl nicht unbedeutender Gemälde aus dem älte‐
ren Münchener Künstlerkreis. Immerhin genug,
um neben den hier nicht genannten bedeutende‐
ren Werken den Ausgangspunkt einer kleinen
guten Gemäldesammlung darzustellen.
dacht, ist zurzeit noch die reichhaltige Sammlung
von Stichen, Zeichnungen und andern Kunstblät‐
tern, die sich auf die Geschichte von Görlitz, die
Geschichte der Oberlausitz beziehen.
falls nach den Interessen der Heimatgeschichte
orientierte kunstgewerbliche und kunsthistori‐
sche Sammlung in den beiden Flügeln des Erd‐
geschosses, während die Oberlausitzer Zimmer in
den Souterrain-Räumen nebst vielem andern,
das dort seinen Platz fand, diese Sammlungen le‐
bendig ergänzen.
.Ein kleines Museum für sich ist der Urge‐
schichte gewidmet und ebenfalls in den Keller‐
räumen untergebracht. Der Archäologe, der die
Oberlausitzer Keramik studiert, kann auf die
Kenntnis dieser zum Teil sehr hervorragenden
Funde nicht verzichten, während sie dem Laien
ein Bild fernster Vorzeit geben.
.Erstaunlich viel Belehrendes bieten diese un‐
tersten Räume, in denen zu allem Überfluß noch
zwei recht eigenartige und des Ansehens werte
Kleinwerke der Volkskunst, zwei sogenannte
«Krippen»-Darstellungen Platz fanden, um die das
Museum wohl von der berühmten Münchner
Krippensammlung im bayrischen Nationalmu‐
seum nicht wenig beneidet werden dürfte.
.Der Fleiß einfacher Handwerker hat diese Dar‐
stellungen in jahrelanger mühevoller Arbeit ge‐
schaffen. Die eine schildert nur die Geburt Christi
mit den üblichen anachronistischen, volkstümli‐
chen Beigaben, so daß der ganze Hergang in die
sche Sammlung in den beiden Flügeln des Erd‐
geschosses, während die Oberlausitzer Zimmer in
den Souterrain-Räumen nebst vielem andern,
das dort seinen Platz fand, diese Sammlungen le‐
bendig ergänzen.
schichte gewidmet und ebenfalls in den Keller‐
räumen untergebracht. Der Archäologe, der die
Oberlausitzer Keramik studiert, kann auf die
Kenntnis dieser zum Teil sehr hervorragenden
Funde nicht verzichten, während sie dem Laien
ein Bild fernster Vorzeit geben.
tersten Räume, in denen zu allem Überfluß noch
zwei recht eigenartige und des Ansehens werte
Kleinwerke der Volkskunst, zwei sogenannte
«Krippen»-Darstellungen Platz fanden, um die das
Museum wohl von der berühmten Münchner
Krippensammlung im bayrischen Nationalmu‐
seum nicht wenig beneidet werden dürfte.
stellungen in jahrelanger mühevoller Arbeit ge‐
schaffen. Die eine schildert nur die Geburt Christi
mit den üblichen anachronistischen, volkstümli‐
chen Beigaben, so daß der ganze Hergang in die
engere Heimat versetzt erscheint, die andere
«Krippe» ist eigentlich ein vollständiges Passions‐
spiel, beginnend mit der Geburtsgeschichte und
endigend mit der Auferstehung. Und das alles ist
durch eine Anzahl sinnreicher Anordnungen in
geradezu verblüffend natürlicher Weise beweg‐
lich.
.Bei der Kreuzabnahme wird selbst der Leich‐
nam Christi frei vom Kreuze heruntergeholt! Al‐
les ist so naiv aus dem Geiste echter Volkskunst
entstanden, daß die Beweglichkeit der Figuren
nur den künstlerischen Eindruck verstärkt, statt
ihn etwa zu stören. Wer bei dem dreimaligen Ge‐
bet Jesu im Garten am Ölberg nicht durch die Be‐
wegung des bis in den Tod Betrübten ergriffen
wird, der muß jedes Gefühl für volkstümliche
Einfühlung in die Begebnisse christlicher Heils‐
geschichte verloren haben. ‒
.Und das alles hat man hier unten mustergültig
aufgestellt. Ein Beamter des Museums, auch ein
einfacher, tüchtiger Handwerker besten alten
Schlages, obwohl ein noch jüngerer Mann, der
auch die Vorführungen unternimmt, hat all diese
Einzelteile mit feinstem Verständnis wieder zu‐
sammengesetzt, die «mechanische Kunst» daran
in sinngemäßer Weise wiederhergestellt und in
liebevoller Hingabe beide «Krippen» in den zur
«Krippe» ist eigentlich ein vollständiges Passions‐
spiel, beginnend mit der Geburtsgeschichte und
endigend mit der Auferstehung. Und das alles ist
durch eine Anzahl sinnreicher Anordnungen in
geradezu verblüffend natürlicher Weise beweg‐
lich.
nam Christi frei vom Kreuze heruntergeholt! Al‐
les ist so naiv aus dem Geiste echter Volkskunst
entstanden, daß die Beweglichkeit der Figuren
nur den künstlerischen Eindruck verstärkt, statt
ihn etwa zu stören. Wer bei dem dreimaligen Ge‐
bet Jesu im Garten am Ölberg nicht durch die Be‐
wegung des bis in den Tod Betrübten ergriffen
wird, der muß jedes Gefühl für volkstümliche
Einfühlung in die Begebnisse christlicher Heils‐
geschichte verloren haben. ‒
aufgestellt. Ein Beamter des Museums, auch ein
einfacher, tüchtiger Handwerker besten alten
Schlages, obwohl ein noch jüngerer Mann, der
auch die Vorführungen unternimmt, hat all diese
Einzelteile mit feinstem Verständnis wieder zu‐
sammengesetzt, die «mechanische Kunst» daran
in sinngemäßer Weise wiederhergestellt und in
liebevoller Hingabe beide «Krippen» in den zur
Verfügung stehenden Räumen aufgebaut, was
gewiß keine leichte Arbeit war und einen beson‐
ders feinen seelischen Takt erforderte, um das
Unberührte, das Wesentliche der alten Origi‐
nalarbeit zu erhalten.
.Das wäre so in aller Kürze, jedem Besucher des
Museums nicht fremd, der wesentlichste Inhalt
der Räume.
.Eine bedeutende Münzensammlung sowie
noch manches andere harrt des Tages, an dem
ein schon längst geplanter, aber jetzt auf unbe‐
stimmte Zeit hinaus verschobener Erweiterungs‐
bau doch einst seine Vollendung finden wird.
.Es wäre zu wünschen, daß das Museum immer
mehr Gönner finden möge, die es durch Legate
und sonstige Schenkungen, seien es nun kunst‐
und kulturhistorisch wichtige und wertvolle
Werke, seien es die so dringend nötigen größeren
Barmittel, in den Stand setzen würden, seiner ho‐
hen Aufgabe für das kulturelle Leben der Stadt
Görlitz und im weiteren Sinne der gesamten
Oberlausitz in mustergültiger Weise zu genügen.
.Aber schließlich ist auch ein «Heimatmuseum»
keine isolierte, nur auf den Bannkreis seiner Stadt
oder ihrer nächsten Umgebung beschränkte Ein‐
gewiß keine leichte Arbeit war und einen beson‐
ders feinen seelischen Takt erforderte, um das
Unberührte, das Wesentliche der alten Origi‐
nalarbeit zu erhalten.
Museums nicht fremd, der wesentlichste Inhalt
der Räume.
noch manches andere harrt des Tages, an dem
ein schon längst geplanter, aber jetzt auf unbe‐
stimmte Zeit hinaus verschobener Erweiterungs‐
bau doch einst seine Vollendung finden wird.
mehr Gönner finden möge, die es durch Legate
und sonstige Schenkungen, seien es nun kunst‐
und kulturhistorisch wichtige und wertvolle
Werke, seien es die so dringend nötigen größeren
Barmittel, in den Stand setzen würden, seiner ho‐
hen Aufgabe für das kulturelle Leben der Stadt
Görlitz und im weiteren Sinne der gesamten
Oberlausitz in mustergültiger Weise zu genügen.
keine isolierte, nur auf den Bannkreis seiner Stadt
oder ihrer nächsten Umgebung beschränkte Ein‐
richtung, wenn auch die Vorteile, die es durch
seinen Ruf einer Stadt bringen kann, dieser allein
zugute kommen.
.In diesem Sinne ist jeder Einwohner von Gör‐
litz zwar praktisch an dem Gedeihen und Be‐
kanntwerden des heimischen Museums inter‐
essiert, aber dieser Ruf, dieses Bekanntwerden ist
nur zu erreichen dadurch, daß sich die Museums‐
leitung in den Dienst der gesamten Kunstwissen‐
schaft stellt und die Verbindung mit allen Museen
in deutschem Sprachgebiet stets aufrecht erhält.
Die hierzu nötige Arbeit übersteigt aber die Kraft
eines einzelnen Mannes, sei er auch wie der der‐
zeitige Leiter und Schöpfer des Museums ein
Hüne an Arbeitskraft. Mit ungeschulten und billi‐
gen Hilfskräften ist hier gar nichts geholfen. Nö‐
tig wäre die Assistenz einer wissenschaftlich gebil‐
deten und in den Aufgaben eines Museumsbeam‐
ten nicht ganz unerfahrenen Persönlichkeit.
.Da die Stadt Görlitz zurzeit mit Aufgaben über‐
lastet ist, die es ihr wohl unmöglich machen dürf‐
ten, eine solche Hilfskraft zu besolden (obwohl
der wissenschaftliche Arbeiter auch heute noch aus
Liebe zur Sache zu arbeiten pflegt und daher in sei‐
nen Ansprüchen weitaus bescheidener ist als
mancher Fabrikarbeiter), so könnte man es nur
als eine hochherzige Tat bezeichnen, wenn von
seinen Ruf einer Stadt bringen kann, dieser allein
zugute kommen.
litz zwar praktisch an dem Gedeihen und Be‐
kanntwerden des heimischen Museums inter‐
essiert, aber dieser Ruf, dieses Bekanntwerden ist
nur zu erreichen dadurch, daß sich die Museums‐
leitung in den Dienst der gesamten Kunstwissen‐
schaft stellt und die Verbindung mit allen Museen
in deutschem Sprachgebiet stets aufrecht erhält.
Die hierzu nötige Arbeit übersteigt aber die Kraft
eines einzelnen Mannes, sei er auch wie der der‐
zeitige Leiter und Schöpfer des Museums ein
Hüne an Arbeitskraft. Mit ungeschulten und billi‐
gen Hilfskräften ist hier gar nichts geholfen. Nö‐
tig wäre die Assistenz einer wissenschaftlich gebil‐
deten und in den Aufgaben eines Museumsbeam‐
ten nicht ganz unerfahrenen Persönlichkeit.
lastet ist, die es ihr wohl unmöglich machen dürf‐
ten, eine solche Hilfskraft zu besolden (obwohl
der wissenschaftliche Arbeiter auch heute noch aus
Liebe zur Sache zu arbeiten pflegt und daher in sei‐
nen Ansprüchen weitaus bescheidener ist als
mancher Fabrikarbeiter), so könnte man es nur
als eine hochherzige Tat bezeichnen, wenn von
privater Seite die Kosten einer solchen Hilfe für
die Museumsleitung übernommen würden.
.Es wäre die denkbar übelste Verkennung des
Nötigen, wenn man den fruchtbringenden Be‐
stand eines Museums in heutiger Zeit als überflüs‐
sigen Luxus ansehen wollte. ‒ «Nicht vom Brote
allein lebt der Mensch, sondern von jedem Worte,
das aus dem Munde Gottes kommt.» ‒
.Ein jedes Werk bedeutender Vorzeit, alles, was
die Gegenwart an wirklich Gehaltvollem schafft,
ist solch ein «Wort Gottes», das zu empfänglichen
Herzen, insonderheit zu den Gemütern der Ju‐
gend, oft wuchtiger sprechen kann als Schule und
Kirche es vermögen, gerade weil all diese sicht‐
baren, greifbaren Dinge so ganz auf das praktische,
tagtägliche Leben hinweisen. Alles, was heute den
allenthalben im praktischen Leben grassierenden
Materialismus zurückdämmen kann, dient dem
Wiederaufbau, ist eine nicht zu missende und ihre
Unterschätzung bitter rächende Kraft, die zur
Gesundung unsres Lebens führt. ‒ ‒
Was das Buch für das Denken bedeutet, das ist der
sichtbare Gegenstand, wenn er von Kunst, Ge‐
schmack und handwerklicher Tüchtigkeit zeugt,
für das Gemüt. ‒ Aus dem Gefühl heraus aber muß
die Kraft zur Wiederaufrichtung unsres Volkes
die Museumsleitung übernommen würden.
Nötigen, wenn man den fruchtbringenden Be‐
stand eines Museums in heutiger Zeit als überflüs‐
sigen Luxus ansehen wollte. ‒ «Nicht vom Brote
allein lebt der Mensch, sondern von jedem Worte,
das aus dem Munde Gottes kommt.» ‒
die Gegenwart an wirklich Gehaltvollem schafft,
ist solch ein «Wort Gottes», das zu empfänglichen
Herzen, insonderheit zu den Gemütern der Ju‐
gend, oft wuchtiger sprechen kann als Schule und
Kirche es vermögen, gerade weil all diese sicht‐
baren, greifbaren Dinge so ganz auf das praktische,
tagtägliche Leben hinweisen. Alles, was heute den
allenthalben im praktischen Leben grassierenden
Materialismus zurückdämmen kann, dient dem
Wiederaufbau, ist eine nicht zu missende und ihre
Unterschätzung bitter rächende Kraft, die zur
Gesundung unsres Lebens führt. ‒ ‒
sichtbare Gegenstand, wenn er von Kunst, Ge‐
schmack und handwerklicher Tüchtigkeit zeugt,
für das Gemüt. ‒ Aus dem Gefühl heraus aber muß
die Kraft zur Wiederaufrichtung unsres Volkes
kommen. Das Denken geht irre Wege, wenn es
nicht durch das Gefühl in gesunde Bahnen gelei‐
tet wird. ‒ Was wir heute alle beklagen, ist nicht
zum wenigsten die Frucht irregeleiteten Denkens,
die Folge davon, daß man das Volk systematisch
daran gewöhnte zu glauben, alles Gute müsse sich
erdenken lassen, daß man Kopfmenschen, Gehirn‐
menschen erzog, aber keine Menschen, die sehen
können und durch Sehen zu lernen wissen. ‒ Dies
aber lehrt in erster Linie ein Museum.
nicht durch das Gefühl in gesunde Bahnen gelei‐
tet wird. ‒ Was wir heute alle beklagen, ist nicht
zum wenigsten die Frucht irregeleiteten Denkens,
die Folge davon, daß man das Volk systematisch
daran gewöhnte zu glauben, alles Gute müsse sich
erdenken lassen, daß man Kopfmenschen, Gehirn‐
menschen erzog, aber keine Menschen, die sehen
können und durch Sehen zu lernen wissen. ‒ Dies
aber lehrt in erster Linie ein Museum.
Im Bankettsaal der Stadthalle wurde gestern gegen 11½ 00
Uhr vom neuen Vorsitzenden des Kunstvereins, Herrn Jo‐ 00
seph Schneider–Franken*, die Ausstellung Neumann–Hegen‐ 00
berg und Paul Polte eröffnet. Ein guter Anfang unter der 00
neuen Leitung, die, wie wir hoffen, noch recht ersprieß‐ 00
liche Arbeit auf diesem Gebiete des Kunstlebens leisten 00
wird, um dadurch der Stadt Görlitz auch nach außenhin 00
in dieser Beziehung einen Namen zu machen. Wir wün‐ 00
schen dem neuen Vorsitzenden den besten Erfolg.
Zur Eröffnung der Ausstellung führte er aus:
Uhr vom neuen Vorsitzenden des Kunstvereins, Herrn Jo‐ 00
seph Schneider–Franken*, die Ausstellung Neumann–Hegen‐ 00
berg und Paul Polte eröffnet. Ein guter Anfang unter der 00
neuen Leitung, die, wie wir hoffen, noch recht ersprieß‐ 00
liche Arbeit auf diesem Gebiete des Kunstlebens leisten 00
wird, um dadurch der Stadt Görlitz auch nach außenhin 00
in dieser Beziehung einen Namen zu machen. Wir wün‐ 00
schen dem neuen Vorsitzenden den besten Erfolg.
Zur Eröffnung der Ausstellung führte er aus:
Meine Damen und Herren!
.Der Kunstverein hat vor kurzem seinen lang‐
jährigen und verdienstvollen Vorsitzenden durch
den Tod verloren, und mir wird nun die Aufgabe,
die für das kulturelle Leben dieser Stadt so wich‐
tige Vereinigung zu leiten.
jährigen und verdienstvollen Vorsitzenden durch
den Tod verloren, und mir wird nun die Aufgabe,
die für das kulturelle Leben dieser Stadt so wich‐
tige Vereinigung zu leiten.
* Da die beglaubigte Namensänderung in «Schneider‐ 00
franken» erst Ende August 1920 erfolgte, sind sämtliche 00
Artikel über Kunst mit Joseph oder J. A. Schneider-Fran‐ 00
ken gezeichnet.
franken» erst Ende August 1920 erfolgte, sind sämtliche 00
Artikel über Kunst mit Joseph oder J. A. Schneider-Fran‐ 00
ken gezeichnet.
.Daß am Beginn meiner Tätigkeit gleich eine so
hervorragende Ausstellung steht, wie die ist, die
ich hier nun eröffnen soll, ist nicht mein Ver‐
dienst.
.Ich danke aber den Herren des Vorstandes,
daß sie den beiden Künstlern, die hier ausstellen,
Gelegenheit gaben, ihre Werke zu zeigen.
.Ich kann mit voller Überzeugung und warmen
Herzens für diese Ausstellung eintreten.
.An anderer Stelle zeigte ich vor kurzem, daß die
Richtung, der ein Künstler zugezählt wird, eigent‐
lich Nebensache ist, daß es einzig darauf ankommt,
ob ein Künstler zu den Echten und Wahrhaftigen,
oder aber nur zu denen zu zählen ist, die irgend‐
einer Richtung nachlaufen, weil sie selbst nichts Ei‐
genes zu sagen haben.
.Die Ausstellung, die Sie jetzt sehen werden,
zeigt in lebendiger Gestaltung, wie wenig es auf
die Richtung ankommt, wie die Persönlichkeit eines
Künstlers ganz allein für die Wertung seines Schaf‐
fens maßgebend ist.
.Man kann sich kaum verschiedenere Richtungen
vorstellen als die sind, die durch die beiden aus‐
stellenden Künstler vertreten werden.
hervorragende Ausstellung steht, wie die ist, die
ich hier nun eröffnen soll, ist nicht mein Ver‐
dienst.
daß sie den beiden Künstlern, die hier ausstellen,
Gelegenheit gaben, ihre Werke zu zeigen.
Herzens für diese Ausstellung eintreten.
Richtung, der ein Künstler zugezählt wird, eigent‐
lich Nebensache ist, daß es einzig darauf ankommt,
ob ein Künstler zu den Echten und Wahrhaftigen,
oder aber nur zu denen zu zählen ist, die irgend‐
einer Richtung nachlaufen, weil sie selbst nichts Ei‐
genes zu sagen haben.
zeigt in lebendiger Gestaltung, wie wenig es auf
die Richtung ankommt, wie die Persönlichkeit eines
Künstlers ganz allein für die Wertung seines Schaf‐
fens maßgebend ist.
vorstellen als die sind, die durch die beiden aus‐
stellenden Künstler vertreten werden.
.Der Maler, dem ja der größte Anteil an der Aus‐
stellung zufällt, geht von der Darstellung der äus‐
seren Umwelt aus und sucht und findet schließ‐
lich die Ausdrucksmittel, um die reiche Bewe‐
gung seiner inneren Welt zu gestalten.
.Er sucht seine großen Vorbilder in der Gotik,
vor allem in Mathias Grünewald, dem Meister des
Isenheimer Altars, und man könnte ihn äußerlich
zu den «Expressionisten» rechnen, doch ist er eine
ganz auf sich gestellte Persönlichkeit, der es gar
nicht einfällt, eines Programmes wegen zu malen. ‒
.Er malt so, wie er malt, weil er so malen muß,
wenn er sich selbst treu bleiben will.
.Das Gleiche ist von dem Bildhauer zu sagen.
.Auch er gibt, als Plastiker, was er seiner Natur
nach geben muß, aber in ihm ist nur statuarische
Ruhe und verhaltenes Leben, kein Drang zu dramati‐
scher Bewegung der Formen, wie in dem Maler.
.Seine Richtung, wenn man ihn unbedingt einer
zuzählen will, ist die Richtung der großen deut‐
schen Monumentalplastiker, der Wrba, Beermann,
Hahn und anderer, die alle mehr oder weniger
von Hildebrandt und seiner Auffassung des «Pro‐
blems der Form» ausgehen.
stellung zufällt, geht von der Darstellung der äus‐
seren Umwelt aus und sucht und findet schließ‐
lich die Ausdrucksmittel, um die reiche Bewe‐
gung seiner inneren Welt zu gestalten.
vor allem in Mathias Grünewald, dem Meister des
Isenheimer Altars, und man könnte ihn äußerlich
zu den «Expressionisten» rechnen, doch ist er eine
ganz auf sich gestellte Persönlichkeit, der es gar
nicht einfällt, eines Programmes wegen zu malen. ‒
wenn er sich selbst treu bleiben will.
nach geben muß, aber in ihm ist nur statuarische
Ruhe und verhaltenes Leben, kein Drang zu dramati‐
scher Bewegung der Formen, wie in dem Maler.
zuzählen will, ist die Richtung der großen deut‐
schen Monumentalplastiker, der Wrba, Beermann,
Hahn und anderer, die alle mehr oder weniger
von Hildebrandt und seiner Auffassung des «Pro‐
blems der Form» ausgehen.
.Der Plastiker, Paul Polte, dürfte Ihnen ohne
weiteres verständlich sein.
.Sie sehen die große Ruhe und Geschlossenheit sei‐
ner Figuren und die vollendet schöne Modellierung,
den feinen seelischen Ausdruck in allen seinen Wer‐
ken ohne Mühe.
.Der Maler, Neumann-Hegenberg, verlangt mehr
willige Einstellung von Ihnen.
.Er will Ihnen seine Entwicklung zeigen, will zei‐
gen, wieso er dazu kommen mußte, seine letzten
Werke zu schaffen.
.Die Bilder sind deshalb auch in chronologi‐
scher Reihenfolge aufgehängt, von den starken
und räumlich tiefen Schilderungen der Umwelt
angefangen, bis zu den Werken, in denen er rein
seelisch Geschautes zeigt, dem oft ein Naturein‐
druck, oft ein musikalisches Erleben oder aber nur
innerlich Empfundenes zu Grunde liegt.
.Neumann-Hegenberg will immer noch weiter,
sucht stets noch neue Ausdrucksmöglichkeiten und
betrachtet auch seine letzten Bilder noch nicht als
sein «letztes Wort».
.Aber vieles von dem, was er zeigt, stellt auch, ho‐
hen kritischen Ansprüchen gegenüber, eine restlos
vollkommene Lösung dar.
weiteres verständlich sein.
ner Figuren und die vollendet schöne Modellierung,
den feinen seelischen Ausdruck in allen seinen Wer‐
ken ohne Mühe.
willige Einstellung von Ihnen.
gen, wieso er dazu kommen mußte, seine letzten
Werke zu schaffen.
scher Reihenfolge aufgehängt, von den starken
und räumlich tiefen Schilderungen der Umwelt
angefangen, bis zu den Werken, in denen er rein
seelisch Geschautes zeigt, dem oft ein Naturein‐
druck, oft ein musikalisches Erleben oder aber nur
innerlich Empfundenes zu Grunde liegt.
sucht stets noch neue Ausdrucksmöglichkeiten und
betrachtet auch seine letzten Bilder noch nicht als
sein «letztes Wort».
hen kritischen Ansprüchen gegenüber, eine restlos
vollkommene Lösung dar.
.Sie haben es mit einem tiefernsten, ehrlich mit
seiner Kunst ringenden Manne zu tun, der alles
Halbe und nur beiläufig Gute weit hinter sich läßt.
.Er dichtet mit dem Pinsel in der Hand farbige
Werke voller Glut des Erlebens, voller Intensität
der inneren Bewegtheit.
.Sie wissen alle, was der Rhythmus in der Musik
bedeutet.
.Diesen Rhythmus finden Sie wieder, wenn Sie
die Gemälde dieses Malers betrachten, und Sie
müssen nach dem Rhythmus suchen, wenn Sie
den inneren Wert dieser Bilder erkennen und ih‐
nen gerecht werden wollen.
.Folgerichtig sieht man auch seine Auffassungsart
und seine Technik sich entwickeln.
.Nichts ist «gesucht», alles Spätere entwickelt sich
mit Notwendigkeit aus dem Früheren. Er malt, was
ihm sein Innerstes befiehlt.
.Daß außer aller malerischen Qualität auch viel
Poesie in den meisten Werken steckt, wird ihm si‐
cher auch manche Verehrer gewinnen, die für das
eminent Malerische der Bilder noch nicht das
rechte Auge haben.
seiner Kunst ringenden Manne zu tun, der alles
Halbe und nur beiläufig Gute weit hinter sich läßt.
Werke voller Glut des Erlebens, voller Intensität
der inneren Bewegtheit.
bedeutet.
die Gemälde dieses Malers betrachten, und Sie
müssen nach dem Rhythmus suchen, wenn Sie
den inneren Wert dieser Bilder erkennen und ih‐
nen gerecht werden wollen.
und seine Technik sich entwickeln.
mit Notwendigkeit aus dem Früheren. Er malt, was
ihm sein Innerstes befiehlt.
Poesie in den meisten Werken steckt, wird ihm si‐
cher auch manche Verehrer gewinnen, die für das
eminent Malerische der Bilder noch nicht das
rechte Auge haben.
.Ich hoffe, daß niemand diese Ausstellung ver‐
läßt, ohne einen reichen und nachhaltigen Ein‐
druck mitzunehmen.
.Ich möchte hier nur noch sagen, daß ich den
Wunsch hege, den Kunstverein in dieser Stadt zu
einer Instanz zu machen, der das Laienpublikum
bei seinen Ankäufen und Kunstbesichtigungen
absolut vertrauen kann.
.Man soll wissen, daß in seinen Ausstellungen
nur echte und reife Kunst geboten wird.
.Ich danke den beiden Ausstellern, daß sie mir
diesen verheißungsvollen Anfang ermöglicht ha‐
ben!
läßt, ohne einen reichen und nachhaltigen Ein‐
druck mitzunehmen.
Wunsch hege, den Kunstverein in dieser Stadt zu
einer Instanz zu machen, der das Laienpublikum
bei seinen Ankäufen und Kunstbesichtigungen
absolut vertrauen kann.
nur echte und reife Kunst geboten wird.
diesen verheißungsvollen Anfang ermöglicht ha‐
ben!
Die neue, überaus reichhaltige Kunstausstellung des 00
Kunstvereins für die Lausitz fand gestern vor geladenen Gä‐ 00
sten im Bankettsaal der Stadthalle ihre Eröffnung. Der 00
Vorsitzende des Kunstvereins, Herr Schneider-Franken, 00
führte in seiner Eröffnungsansprache etwa folgendes aus: 00
Kunstvereins für die Lausitz fand gestern vor geladenen Gä‐ 00
sten im Bankettsaal der Stadthalle ihre Eröffnung. Der 00
Vorsitzende des Kunstvereins, Herr Schneider-Franken, 00
führte in seiner Eröffnungsansprache etwa folgendes aus: 00
tung die Aufgabe gestellt, an möglichst markan‐
ten Beispielen zu zeigen, wie das wirklich Wertvolle
in der Kunst ganz unabhängig ist von der jeweili‐
gen Richtung, zu der man den oder jenen Künstler
zählen mag. Es ist nicht gerade überflüssig, dies
immer wieder zu betonen, denn in manchen
Kreisen herrscht immer noch die Auffassung,
eine Ausstellungsleitung müsse sich zu dieser
oder jener «Richtung» bekennen und könne darum
den anderen Richtungen «nicht gerecht» werden.
wo wir sie auch finden, und wir finden in jeder
Richtung echte und wahrhafte Kunst, wie wir in jeder
Richtung auch allerlei Scheinkunst abzulehnen ha‐
ben.
.Der Künstler, dem die heute zu eröffnende
Ausstellung gilt, wird Ihnen in schönster Weise
wieder zeigen, was wir unter Kunst verstehen, und
daß wir durchaus nicht nur etwa dem «Expressio‐
nismus» das Wort reden wollen, auch wenn wir in
dieser Kunstrichtung besonders hohe und zukunfts‐
reiche Werte im Entstehen sehen, Werte, die wir
auf jede Weise ans Licht zu ziehen suchen.
.Otto Wilhelm Merseburg*, dessen Werke Sie nun
in einer reichen Auswahl sehen werden, ist ein
Künstler, der sich längst schon seinen Namen zu
schaffen wußte, auch wenn ihn vielleicht hier erst
noch wenige kennen werden.
.Seine Bilder wurden von großen Staatsgalerien
angekauft und hängen längst in bedeutenden Pri‐
vatsammlungen.
.Sie werden das verstehen, wenn Sie nun Gele‐
genheit finden, sein Schaffen kennen zu lernen.
.Hervorgegangen ist er seinerzeit aus der Schule
Eugen Brachts, wenn auch Bautzer und andere
Richtung auch allerlei Scheinkunst abzulehnen ha‐
ben.
Ausstellung gilt, wird Ihnen in schönster Weise
wieder zeigen, was wir unter Kunst verstehen, und
daß wir durchaus nicht nur etwa dem «Expressio‐
nismus» das Wort reden wollen, auch wenn wir in
dieser Kunstrichtung besonders hohe und zukunfts‐
reiche Werte im Entstehen sehen, Werte, die wir
auf jede Weise ans Licht zu ziehen suchen.
in einer reichen Auswahl sehen werden, ist ein
Künstler, der sich längst schon seinen Namen zu
schaffen wußte, auch wenn ihn vielleicht hier erst
noch wenige kennen werden.
angekauft und hängen längst in bedeutenden Pri‐
vatsammlungen.
genheit finden, sein Schaffen kennen zu lernen.
Eugen Brachts, wenn auch Bautzer und andere
* Deutscher Maler und Radierer (1874-1947)
Meister Einwirkungen auf seinen Werdegang
hinterließen.
.Heute steht er lange schon als ein durchaus im ei‐
genen Erdreich Wurzelnder vor Ihnen, als ein Ma‐
ler von hohem Rang, der seine eigene Richtung sich
selber schuf, und den man vielleicht mit Boehle,
Thoma und Steinhausen in manche Parallele setzen
kann. Seine ganze Kunst ist erfüllt von einer star‐
ken und hingebenden Liebe zur Natur, ‒ insbeson‐
dere zur Natur und zu den Menschen seiner en‐
geren Thüringer Heimat, ‒ und in jedem seiner
Werke spricht sich eine ungemein reiche, tief emp‐
findende Seele aus.
.Sie werden diesem Künstler ohne weiteres zu
folgen vermögen, auch ohne jede weitere «Erklä‐
rung» seiner Werke. Ich bitte Sie aber, besonders
auf die großen Bilder an der Stirnwand des Saales
achten zu wollen. Diese Bilder tragen Ewigkeits‐
charakter und bilden gleichsam die Stimmgabel
zur ganzen Ausstellung, in der dieser «Ewigkeits‐
charakter» oft auch noch im kleinsten Blättchen
vielfach wiederkehrt.
.Daß Merseburg auch als Portraitist eine nicht
unbedeutende Stellung einnimmt, möchte ich
nur noch nebenbei erwähnen, und Sie werden ja
selbst Gelegenheit finden, sich jetzt auch in dieser
Hinsicht ein Urteil zu bilden.
hinterließen.
genen Erdreich Wurzelnder vor Ihnen, als ein Ma‐
ler von hohem Rang, der seine eigene Richtung sich
selber schuf, und den man vielleicht mit Boehle,
Thoma und Steinhausen in manche Parallele setzen
kann. Seine ganze Kunst ist erfüllt von einer star‐
ken und hingebenden Liebe zur Natur, ‒ insbeson‐
dere zur Natur und zu den Menschen seiner en‐
geren Thüringer Heimat, ‒ und in jedem seiner
Werke spricht sich eine ungemein reiche, tief emp‐
findende Seele aus.
folgen vermögen, auch ohne jede weitere «Erklä‐
rung» seiner Werke. Ich bitte Sie aber, besonders
auf die großen Bilder an der Stirnwand des Saales
achten zu wollen. Diese Bilder tragen Ewigkeits‐
charakter und bilden gleichsam die Stimmgabel
zur ganzen Ausstellung, in der dieser «Ewigkeits‐
charakter» oft auch noch im kleinsten Blättchen
vielfach wiederkehrt.
unbedeutende Stellung einnimmt, möchte ich
nur noch nebenbei erwähnen, und Sie werden ja
selbst Gelegenheit finden, sich jetzt auch in dieser
Hinsicht ein Urteil zu bilden.
.Ich danke auch an dieser Stelle dem Künstler,
daß er keine Mühe, keine Kosten und keine son‐
stigen Schwierigkeiten scheute, um uns diese
reichhaltige Kunstschau zu ermöglichen, und ich
hoffe, daß seine Kunst hier in Görlitz viele neue
Freunde und Verehrer finden wird.”
daß er keine Mühe, keine Kosten und keine son‐
stigen Schwierigkeiten scheute, um uns diese
reichhaltige Kunstschau zu ermöglichen, und ich
hoffe, daß seine Kunst hier in Görlitz viele neue
Freunde und Verehrer finden wird.”
WENN ich mir die Frage vorlege, wie dieser
große Altmeister deutscher Kunst an sei‐
nem Ehrentage am besten zu erfreuen wäre, dann
glaube ich, es könnte ihm nichts lieber sein, als
wenn ihm eine Schar Kinder, ungeputzt, wie sie
gerade vom Spielen kommen, Buben und Mädel,
schlicht und recht, wie es Kinder eben können,
vor seinem Fenster einfache deutsche Volkslieder
singen würde.
.Wie deutsche Volkslieder, sind ja auch alle
seine Bilder nur entstanden aus der naiven
Freude an der lieben, schönen Gotteswelt, an
Busch, Bach und Baum, an Wiese und Wald, und
an den guten, einfachen Menschen, die das
Volkslied kennt.
.Auch wenn er seine Gestalten aus Mythe und
Sage nimmt, oder wenn sie seiner schauenden
Phantasie entstammen, gibt er sie so, wie nur un‐
verdorbenes, reines und einfachstes Empfinden
sie sich vorzustellen vermag.
große Altmeister deutscher Kunst an sei‐
nem Ehrentage am besten zu erfreuen wäre, dann
glaube ich, es könnte ihm nichts lieber sein, als
wenn ihm eine Schar Kinder, ungeputzt, wie sie
gerade vom Spielen kommen, Buben und Mädel,
schlicht und recht, wie es Kinder eben können,
vor seinem Fenster einfache deutsche Volkslieder
singen würde.
seine Bilder nur entstanden aus der naiven
Freude an der lieben, schönen Gotteswelt, an
Busch, Bach und Baum, an Wiese und Wald, und
an den guten, einfachen Menschen, die das
Volkslied kennt.
Sage nimmt, oder wenn sie seiner schauenden
Phantasie entstammen, gibt er sie so, wie nur un‐
verdorbenes, reines und einfachstes Empfinden
sie sich vorzustellen vermag.
.Ein unübersehbarer Schatz ist es, den er in den
achtzig Jahren seines Lebens ‒ oder doch min‐
destens sechzig davon ‒ seinem Volke geschenkt
hat.
.Wohl sah er in dieser so langen Zeit gar manche
bedeutende künstlerische Erscheinung in deut‐
schen Landen neben sich wirken, allein, wenn es
gelten soll, den Künstler unseres Zeitalters zu nen‐
nen, der am reinsten deutsches Empfinden, deut‐
sche Poesie im besten Sinne, als Maler zum Aus‐
druck brachte, der alle Naturempfindung, die in
unseren Sagen, Märchen und Liedern beschlos‐
sen ruht, seiner Zeit wieder lebendig vor Augen
führte, dann wird sich kein Zweifel erheben, daß
nur sein Name allein zu nennen ist.
.Auch er ist einst in die Fremde gezogen, um
dort, wo noch lebendige Tradition das Handwerk
des Malers lehren konnte, sich sein Rüstzeug zu
holen, aber als er zurück in die Heimat kam,
wußte er bald, was er mit seinem draußen erwor‐
benen Können beginnen müsse, und streifte alles
ab, was nur Können um seiner selbst willen war,
um seinem schlichten Naturempfinden die ihm
allein gemäße Ausdrucksweise zu schaffen.
.Jahrzehntelang mußte er bitter um Anerken‐
nung ringen, und als sie ihm endlich allgemein
achtzig Jahren seines Lebens ‒ oder doch min‐
destens sechzig davon ‒ seinem Volke geschenkt
hat.
bedeutende künstlerische Erscheinung in deut‐
schen Landen neben sich wirken, allein, wenn es
gelten soll, den Künstler unseres Zeitalters zu nen‐
nen, der am reinsten deutsches Empfinden, deut‐
sche Poesie im besten Sinne, als Maler zum Aus‐
druck brachte, der alle Naturempfindung, die in
unseren Sagen, Märchen und Liedern beschlos‐
sen ruht, seiner Zeit wieder lebendig vor Augen
führte, dann wird sich kein Zweifel erheben, daß
nur sein Name allein zu nennen ist.
dort, wo noch lebendige Tradition das Handwerk
des Malers lehren konnte, sich sein Rüstzeug zu
holen, aber als er zurück in die Heimat kam,
wußte er bald, was er mit seinem draußen erwor‐
benen Können beginnen müsse, und streifte alles
ab, was nur Können um seiner selbst willen war,
um seinem schlichten Naturempfinden die ihm
allein gemäße Ausdrucksweise zu schaffen.
nung ringen, und als sie ihm endlich allgemein
zuteil wurde, hatte er bereits ein halbes Jahrhun‐
dert an Lebensjahren erreicht.
.Spott und Hohn, Geringschätzung und Un‐
verstand hatte er in reichlichem Maße zu erdul‐
den, obwohl das uns heute kaum glaublich er‐
scheint, und nur eine kleine Schar begeisterter
Verehrer seiner frommen und innigen Kunst
wußte ihm zu zeigen, daß seine Bilder Seelen fan‐
den, die sie empfinden konnten, Menschen, die
seine damals schon in reicher Fülle vorhandenen
Meisterwerke würdig schätzten.
.Seit dieser trüben und schweren Zeit des Rin‐
gens, die eines jeden echten Künstlers Schicksal
ist, der sich von der Mode entfernt und mehr als
bloße «gefragte Marktware» zu geben unter‐
nimmt, hat ihm dann die Welt alle Ehren ge‐
bracht, die sie an einen Künstler und bedeuten‐
den Menschen nur vergeben konnte, und so
wurde in späten Jahren doch manches gesühnt,
manches ersetzt, was die Zeit seines jüngeren
Mannesalters ihm schuldig geblieben war.
.Selten hat sich deutlicher, als gerade an Hans
Thoma, gezeigt, daß das erste Bedingnis eines
großen Künstlers die eigene bedeutende Persön‐
lichkeit ist und daß alle manuelle Virtuosität nichts
bedeutet gegenüber dieser Grundvoraussetzung,
dert an Lebensjahren erreicht.
verstand hatte er in reichlichem Maße zu erdul‐
den, obwohl das uns heute kaum glaublich er‐
scheint, und nur eine kleine Schar begeisterter
Verehrer seiner frommen und innigen Kunst
wußte ihm zu zeigen, daß seine Bilder Seelen fan‐
den, die sie empfinden konnten, Menschen, die
seine damals schon in reicher Fülle vorhandenen
Meisterwerke würdig schätzten.
gens, die eines jeden echten Künstlers Schicksal
ist, der sich von der Mode entfernt und mehr als
bloße «gefragte Marktware» zu geben unter‐
nimmt, hat ihm dann die Welt alle Ehren ge‐
bracht, die sie an einen Künstler und bedeuten‐
den Menschen nur vergeben konnte, und so
wurde in späten Jahren doch manches gesühnt,
manches ersetzt, was die Zeit seines jüngeren
Mannesalters ihm schuldig geblieben war.
Thoma, gezeigt, daß das erste Bedingnis eines
großen Künstlers die eigene bedeutende Persön‐
lichkeit ist und daß alle manuelle Virtuosität nichts
bedeutet gegenüber dieser Grundvoraussetzung,
die schließlich auch nach dem härtesten Ringen
den Sieg verleiht.
.Man hat Thoma oft genug mangelndes maleri‐
sches Können, «Verzeichnungen» und ähnliches
vorgeworfen, aber man sehe sich nur einmal die
Jugendwerke an, die noch unter dem Einfluß der
französischen Künstler, besonders dem Courbets,
stehen, und urteile dann, ob der Maler dieser Bil‐
der nicht mit spielender Leichtigkeit imstande ge‐
wesen wäre, durch alle nur denkbare malerische
Bravour zu glänzen.
.Daß er es vorzog, sich eine einfache, schlichte
Weise zu schaffen, bewußten Willens auf alles, was
nur entfernt nach «genialer Mache» aussah, zu
verzichten, war ein befolgtes Gebot seiner von in‐
nen heraus gefestigten, reifen und im Tiefsten
wahren Persönlichkeit.
.Wer einmal in dieses gütige, klare und so le‐
bensvolle Auge blicken durfte, wer öfters diesen
stillen Weisen aus dem Schwarzwald in den
schmiegsamen warmen Tönen seiner Heimat aus
seinem so reichen Leben erzählen hörte, wer zu
stiller Stunde in seiner Werkstatt den Reichtum all
dieser Mappen aus der Jugendzeit von seinen lie‐
ben Händen ausgebreitet sah, der kann diese
Weihestunden nie vergessen, und wüßte, auch
den Sieg verleiht.
sches Können, «Verzeichnungen» und ähnliches
vorgeworfen, aber man sehe sich nur einmal die
Jugendwerke an, die noch unter dem Einfluß der
französischen Künstler, besonders dem Courbets,
stehen, und urteile dann, ob der Maler dieser Bil‐
der nicht mit spielender Leichtigkeit imstande ge‐
wesen wäre, durch alle nur denkbare malerische
Bravour zu glänzen.
Weise zu schaffen, bewußten Willens auf alles, was
nur entfernt nach «genialer Mache» aussah, zu
verzichten, war ein befolgtes Gebot seiner von in‐
nen heraus gefestigten, reifen und im Tiefsten
wahren Persönlichkeit.
bensvolle Auge blicken durfte, wer öfters diesen
stillen Weisen aus dem Schwarzwald in den
schmiegsamen warmen Tönen seiner Heimat aus
seinem so reichen Leben erzählen hörte, wer zu
stiller Stunde in seiner Werkstatt den Reichtum all
dieser Mappen aus der Jugendzeit von seinen lie‐
ben Händen ausgebreitet sah, der kann diese
Weihestunden nie vergessen, und wüßte, auch
wenn er niemals die an schöner Menschlichkeit,
Tiefe und Herzenswärme so reichen Schriften des
Meisters gelesen hätte, wie ernst dieser Schwarz‐
wälder Bauernsohn das Wort des Meisters von
Nazareth nahm: «So ihr nicht werdet wie eines
aus diesen Kleinen, werdet ihr nicht in das Reich
der Himmel finden.» ‒
.Wer ihm, wie ich, zu danken hat, daß er die er‐
sten, tastenden Schritte in das Labyrinth der
Kunst gütig und liebevoll auf rechte Wege wies,
der weiß auch, wie dieser so unendlich schaffens‐
reiche Künstler nicht nur zu schaffen, sondern
auch recht zu beraten versteht.
.Und dieses Wissen darum, daß er andere auf
rechte Wege zu führen vermag, hat ihn wohl auch
bewogen, seine Gedanken über Zeit und Ewigkeit
den Seelen der Menschen darzulegen.
.Alle weltläufige Phrase und nichtssagende
Wortemacherei muß vor dieser ruhigen, mensch‐
lichen Größe verstummen, die das Bedeutendste
und Erhabenste in so kindlich reiner und einfa‐
cher Weise zu sagen unternimmt, daß oberflächli‐
ches Urteil nur zu leicht den köstlichen Kern in so
bescheidener Schale übersieht.
.In diesem großen Meister der Kunst steckt
gleichzeitig ein weiser Seher voll tiefer seelischer
Tiefe und Herzenswärme so reichen Schriften des
Meisters gelesen hätte, wie ernst dieser Schwarz‐
wälder Bauernsohn das Wort des Meisters von
Nazareth nahm: «So ihr nicht werdet wie eines
aus diesen Kleinen, werdet ihr nicht in das Reich
der Himmel finden.» ‒
sten, tastenden Schritte in das Labyrinth der
Kunst gütig und liebevoll auf rechte Wege wies,
der weiß auch, wie dieser so unendlich schaffens‐
reiche Künstler nicht nur zu schaffen, sondern
auch recht zu beraten versteht.
rechte Wege zu führen vermag, hat ihn wohl auch
bewogen, seine Gedanken über Zeit und Ewigkeit
den Seelen der Menschen darzulegen.
Wortemacherei muß vor dieser ruhigen, mensch‐
lichen Größe verstummen, die das Bedeutendste
und Erhabenste in so kindlich reiner und einfa‐
cher Weise zu sagen unternimmt, daß oberflächli‐
ches Urteil nur zu leicht den köstlichen Kern in so
bescheidener Schale übersieht.
gleichzeitig ein weiser Seher voll tiefer seelischer
Erlebnisse, und wenn er nicht all seinem Schauen
Ausdruck zu geben trachtet, so hält ihn sicher nur
die Ehrfurcht vor dem Unbegreifbaren, die Sor‐
ge, Heiligstes zu profanieren, davon ab.
.Was Hans Thoma über das Leben der Seele ge‐
schrieben hat, gehört in all seiner unbekümmer‐
ten, schlichten Erzählerweise zu dem Schönsten,
Feinsten und Tiefsten, das in unserer Zeit zu
Worte ward, obwohl er selbst nicht im mindesten
den Anspruch macht, unter die «Denker» und
«Philosophen» oder die «Dichter» gezählt zu wer‐
den.
.Er liebt ‒ um seine eigenen Worte zu gebrau‐
chen ‒ sein «schönes Handwerk der Malerei» über
alles.
.Er sehnt sich nicht nach dem Ruhm eines
Schriftstellers.
.Aber alle, die das, was er geschrieben hat, gele‐
sen haben, werden ihm dankbar sein, daß er in
hohem Alter sich endlich entschließen konnte,
das niederzulegen, was er uns zu sagen hat.
.Und jetzt, an seinem achtzigsten Geburtstag,
gibt er noch gleichsam als Dank an alle, die sich
freuen, daß er dieses schöne Alter erleben durfte,
seine eigene Lebensgeschichte in Umrissen, vom
Ausdruck zu geben trachtet, so hält ihn sicher nur
die Ehrfurcht vor dem Unbegreifbaren, die Sor‐
ge, Heiligstes zu profanieren, davon ab.
schrieben hat, gehört in all seiner unbekümmer‐
ten, schlichten Erzählerweise zu dem Schönsten,
Feinsten und Tiefsten, das in unserer Zeit zu
Worte ward, obwohl er selbst nicht im mindesten
den Anspruch macht, unter die «Denker» und
«Philosophen» oder die «Dichter» gezählt zu wer‐
den.
chen ‒ sein «schönes Handwerk der Malerei» über
alles.
Schriftstellers.
sen haben, werden ihm dankbar sein, daß er in
hohem Alter sich endlich entschließen konnte,
das niederzulegen, was er uns zu sagen hat.
gibt er noch gleichsam als Dank an alle, die sich
freuen, daß er dieses schöne Alter erleben durfte,
seine eigene Lebensgeschichte in Umrissen, vom
Schwarzwälder Bauernbuben und Uhrenmaler
angefangen, bis zu der Höhe, auf der er heute
weithin sichtbar für alle steht.
.An ihm können wir sehen, was unser Bestes ist. Er
zeigt uns, daß all unsere Kraft nur dann zu wirk‐
lich Bedeutendem führt, wenn sie von allem
Phrasenhaften sich frei erhält, und fest verankert
ist in einer reinen und im besten Sinne gläubigen,
auf sich selbst und den Weltgrund, der sie trägt,
fest vertrauenden Seele. ‒ ‒
.Möge der Achtzigjährige, der noch heute eine
prachtvoll kernige Handschrift schreibt, die wie
ein Bild seiner eigenen Geradheit und Festigkeit
ist, und aus der keiner sein hohes Alter er‐
schließen würde, uns noch manches erhebende
Wort, noch manches seiner seelisch so tief emp‐
fundenen Bilder schenken.
angefangen, bis zu der Höhe, auf der er heute
weithin sichtbar für alle steht.
zeigt uns, daß all unsere Kraft nur dann zu wirk‐
lich Bedeutendem führt, wenn sie von allem
Phrasenhaften sich frei erhält, und fest verankert
ist in einer reinen und im besten Sinne gläubigen,
auf sich selbst und den Weltgrund, der sie trägt,
fest vertrauenden Seele. ‒ ‒
prachtvoll kernige Handschrift schreibt, die wie
ein Bild seiner eigenen Geradheit und Festigkeit
ist, und aus der keiner sein hohes Alter er‐
schließen würde, uns noch manches erhebende
Wort, noch manches seiner seelisch so tief emp‐
fundenen Bilder schenken.
Görlitz, 2.Oktober 1919.
tung, einer ernsteren und heiligeren Auf‐
fassung des Kunstschaffens folgend, mit dem al‐
ten Schlendrian aufräumte und frische, bele‐
bende Luft in ihre Säle einließ, dort erhob sich
noch stets das Zetergeschrei aller derer, die vorher
an gleicher Stelle reichlich Gelegenheit gefunden
hatten, mit den Erzeugnissen ihrer braven
Scheinkunst an erster Stelle zu prangen. Sie kön‐
nen es nicht begreifen, daß das nun anders werden
soll, und fühlen sich gekränkt in ihren ‒ wie sie
meinen ‒ wohlerworbenen Rechten. Nach Grün‐
den suchend für die Unbill, die nach ihrer Ansicht
ihnen widerfährt, gelangen sie niemals dazu, diese
Gründe bei sich selbst zu finden, und stets sind es
natürlich nur «Intrigen», «Ungerechtigkeiten»,
«Unterdrückungssucht» und Schlimmeres, wenn
diese bösen «Modernen» ihnen die Plätze wei‐
gern, die sie früher innehatten.
daß man wirklich gute, echte Kunst, zu der jeder
wahre Kunstfreund «Wallfahrten» unternimmt,
wenn er sie irgendwo wittert, ‒ die selten ist, wie
die Perle in der Muschel, ‒ nur deshalb ablehnen
könnte, weil sie nun einmal der gerade «moder‐
nen» Strömung nicht in den Ausdrucksformen
gleicht. ‒ Man ahnt nicht einmal, welche Ungeheu‐
erlichkeit in einer derart stupiden Unterstellung
liegt! ‒ ‒
.Aber ein altes Sprichwort sagt: «Es sucht keiner
den andern hinterm Ofen, der nicht selbst einmal
dahinter war!» ‒ Die Herrschaften belieben ihre
eigene Haltung einer Kunstart gegenüber, zu der
sie keinen Zugang haben, weil sie wirklich aus den
Tiefen aller Kunstgestaltung schöpft, die ihnen
nie erreichbar waren, auch auf andere Menschen zu
übertragen, denn es ist ihnen schier unfaßbar,
daß diese «Modernen» nicht in gleicher Weise wie
sie selbst das ihnen Fernere verdächtigen sollten...
.Man kann oder will es nicht begreifen, daß einer
guten und ihres Urteils sicheren Ausstellungslei‐
tung ganz und gar nichts daran liegt, aus welcher
«Schule» die Künstler kommen, die sie werten
soll, oder welcher «Richtung» sie vielleicht zuge‐
zählt werden könnten. ‒ Man ist des felsenfesten
Glaubens, daß die Parteilichkeit, die man in sich
selber fühlt, auch anderen befehlen müsse, und hat
keine Vorstellung davon, wie absolut sicher reagie‐
wenn er sie irgendwo wittert, ‒ die selten ist, wie
die Perle in der Muschel, ‒ nur deshalb ablehnen
könnte, weil sie nun einmal der gerade «moder‐
nen» Strömung nicht in den Ausdrucksformen
gleicht. ‒ Man ahnt nicht einmal, welche Ungeheu‐
erlichkeit in einer derart stupiden Unterstellung
liegt! ‒ ‒
den andern hinterm Ofen, der nicht selbst einmal
dahinter war!» ‒ Die Herrschaften belieben ihre
eigene Haltung einer Kunstart gegenüber, zu der
sie keinen Zugang haben, weil sie wirklich aus den
Tiefen aller Kunstgestaltung schöpft, die ihnen
nie erreichbar waren, auch auf andere Menschen zu
übertragen, denn es ist ihnen schier unfaßbar,
daß diese «Modernen» nicht in gleicher Weise wie
sie selbst das ihnen Fernere verdächtigen sollten...
guten und ihres Urteils sicheren Ausstellungslei‐
tung ganz und gar nichts daran liegt, aus welcher
«Schule» die Künstler kommen, die sie werten
soll, oder welcher «Richtung» sie vielleicht zuge‐
zählt werden könnten. ‒ Man ist des felsenfesten
Glaubens, daß die Parteilichkeit, die man in sich
selber fühlt, auch anderen befehlen müsse, und hat
keine Vorstellung davon, wie absolut sicher reagie‐
rend sich der Blick für Echtheit, Wert und wirkliche
Ursprünglichkeit entwickeln läßt, und wie er jede
leise Spur davon entdeckt, wenn sie sich unter ir‐
gendeiner noch so sonderlichen oder alten Hülle
‒ wirklich findet. ‒
.Bringt doch einmal Werke zu so einer Ausstel‐
lung, die durch die Auswahl eines dieser bösen
«Modernen» ihre Gestalt gewinnt, ‒ Werke, die
auch nur in noch so bescheidener Weise irgend‐
etwas von jenen Werten zeigen, die noch im letz‐
ten und unbekanntesten Bildchen schlummern,
das irgendein unbedeutender Schüler eines der
alten holländischen Kleinmaler schuf! ‒ ‒
.Bringt einmal Stilleben und Landschaften, die
auch nur ein Weniges von jener tiefen Liebe, von
jenem echten Kunstgefühl in sich tragen, die
auch noch den geringsten Enkelschüler der
alten Großmeister dieser Kunstgebiete auszeich‐
nen! ‒
.Ihr würdet eure blauen Wunder erleben und
euch vielleicht doch beschämt bekennen müssen,
daß der Maßstab, nach dem die «Modernen» mes‐
sen, euch offenbar allzufremd ist, als daß ihr ihn
verstehen könntet! ‒ ‒ ‒ Freilich, für das, was in
euren Werken euch so wertvoll scheint, hat seine
Skala keine Eintragung. ‒ Aber deshalb soll man
Ursprünglichkeit entwickeln läßt, und wie er jede
leise Spur davon entdeckt, wenn sie sich unter ir‐
gendeiner noch so sonderlichen oder alten Hülle
‒ wirklich findet. ‒
lung, die durch die Auswahl eines dieser bösen
«Modernen» ihre Gestalt gewinnt, ‒ Werke, die
auch nur in noch so bescheidener Weise irgend‐
etwas von jenen Werten zeigen, die noch im letz‐
ten und unbekanntesten Bildchen schlummern,
das irgendein unbedeutender Schüler eines der
alten holländischen Kleinmaler schuf! ‒ ‒
auch nur ein Weniges von jener tiefen Liebe, von
jenem echten Kunstgefühl in sich tragen, die
auch noch den geringsten Enkelschüler der
alten Großmeister dieser Kunstgebiete auszeich‐
nen! ‒
euch vielleicht doch beschämt bekennen müssen,
daß der Maßstab, nach dem die «Modernen» mes‐
sen, euch offenbar allzufremd ist, als daß ihr ihn
verstehen könntet! ‒ ‒ ‒ Freilich, für das, was in
euren Werken euch so wertvoll scheint, hat seine
Skala keine Eintragung. ‒ Aber deshalb soll man
nicht etwa glauben, daß er nur nach «Geschmack»
und «Mode» messe. ‒ ‒ ‒
.Sobald ein Künstler Ausdrucksformen findet,
die nur ihm und seiner Zeit gehören, sollte er nach
der Ansicht dieser armen «Unterdrückten» sofort
unterdrückt werden, damit nur ja sie selbst ihre
Plätze nicht verlieren...
.Es ist aber ein Gebot der Pflicht und der Billig‐
keit, gerade solchen Künstlern, die nicht auf den er‐
sten Blick dem großen Publikum verständlich
sind, die Schwierigkeiten aus dem Weg zu räu‐
men, ganz abgesehen davon, daß eine neue For‐
mensprache doch nicht die Begründung zur Ableh‐
nung geben darf, sobald es sich um wirklich erlebte,
aus ernstem Müssen geborene Kunst handelt. ‒
Was man in jenen Kreisen, die noch immer glau‐
ben, die seichte und innerlich hohle Kunstauffas‐
sung am Leben erhalten zu können, in der sie nun
einmal aufgewachsen sind, der neueren Kunst‐
beurteilung zum Vorwurf macht, das ist gerade
das Gegenteil von «Ungerechtigkeit». ‒
.Es ist die durch keine Vettermichelei zu beir‐
rende, unerbittliche Auswahl des Echten, Ur‐
sprünglichen aus der Menge des Nachempfundenen
und gemächlich aus zweiter Hand Bezogenen, ganz
einerlei, ob älteste oder allerneueste Formen und
und «Mode» messe. ‒ ‒ ‒
die nur ihm und seiner Zeit gehören, sollte er nach
der Ansicht dieser armen «Unterdrückten» sofort
unterdrückt werden, damit nur ja sie selbst ihre
Plätze nicht verlieren...
keit, gerade solchen Künstlern, die nicht auf den er‐
sten Blick dem großen Publikum verständlich
sind, die Schwierigkeiten aus dem Weg zu räu‐
men, ganz abgesehen davon, daß eine neue For‐
mensprache doch nicht die Begründung zur Ableh‐
nung geben darf, sobald es sich um wirklich erlebte,
aus ernstem Müssen geborene Kunst handelt. ‒
Was man in jenen Kreisen, die noch immer glau‐
ben, die seichte und innerlich hohle Kunstauffas‐
sung am Leben erhalten zu können, in der sie nun
einmal aufgewachsen sind, der neueren Kunst‐
beurteilung zum Vorwurf macht, das ist gerade
das Gegenteil von «Ungerechtigkeit». ‒
rende, unerbittliche Auswahl des Echten, Ur‐
sprünglichen aus der Menge des Nachempfundenen
und gemächlich aus zweiter Hand Bezogenen, ganz
einerlei, ob älteste oder allerneueste Formen und
Farbensprache dem innersten Müssen Ausdruck
gibt, oder nur äußerlich eitles Machwerk, mag es
auch dem ungeübten Laienauge noch so «schön»
erscheinen, zutage fördert.
.Die Zeiten sind viel zu ernst geworden, als daß
sie jener innerlich leeren Samtjackenkunst noch
Raum bieten könnten, die früher ihre Triumphe
feierte. Nur was uns wirkliche, dauernde Lebenswerte
aus der Seele Tiefen schürft, hat heute noch seine
Berechtigung und wird sie behalten, solange es
Kunst und Künstler gibt. ‒ ‒ ‒
gibt, oder nur äußerlich eitles Machwerk, mag es
auch dem ungeübten Laienauge noch so «schön»
erscheinen, zutage fördert.
sie jener innerlich leeren Samtjackenkunst noch
Raum bieten könnten, die früher ihre Triumphe
feierte. Nur was uns wirkliche, dauernde Lebenswerte
aus der Seele Tiefen schürft, hat heute noch seine
Berechtigung und wird sie behalten, solange es
Kunst und Künstler gibt. ‒ ‒ ‒
dramen, seine verlogenen Detektivgeschich‐
ten und unmöglichen Sensationsfilme, ohne daß
irgendein Mensch Einspruch erhoben hätte, bis
in die jüngste Zeit. Nun allerdings dämmert es all‐
mählich, und es finden sich, ganz abgesehen von
den verschiedentlichen Demonstrationen der Ju‐
gend, die wohl nicht gerade zweckmäßig sein
dürften, immer mehr gewichtige Stimmen im
Kampf gegen den «Kinoschund».
sich da in unsern Volkskörper fraß, aber ihr Un‐
wille gedieh nicht zu lautem Einspruch, und
wenn je einer es wagte, das Kind beim Namen zu
nennen, fanden seine Worte wenig Widerhall.
Glauben hingeben, man hätte die Mehrzahl der
ernst zu nehmenden Menschen hinter sich, wenn
man auf die Schädlichkeit der Kinodarbietungen
hinweist. In weiten Kreisen, von denen man an‐
nehmen sollte, daß die psychologische Bedenk‐
lichkeit der Kinodramen für sie durchschaubar
sei, begegnet man einer unbegreiflichen Laxheit
des Urteils. Man glaubt, weil man selbst imstande
ist, ohne seelischen Schaden die albernsten Ab‐
surditäten des Flimmerbildes an sich vorüberzie‐
hen zu sehen, es handle sich im Grunde doch nur
um eine «recht harmlose Sache», denn man kann,
oder mag sich nicht in den Seelenzustand der Ju‐
gendlichen oder des nur bedingt urteilsfähigen
Volkes versetzen, um so die vergiftende Wirkung
der allermeisten Filmspiele zu erkennen. Ich
denke dabei durchaus nicht etwa nur an Darstel‐
lungen, deren ganze Absicht es ist, die Sinne auf‐
zureizen, auch wenn keinerlei Nacktheit, keinerlei
im Sinne der Zensur «unsittliche» Situationen ge‐
zeigt werden, obwohl ich auch wieder in keiner
Weise denen beipflichten kann, die das gröbste
Erregen der Sinnlichkeit beinahe als Kulturzweck
feiern, denn ich bin der Ansicht, daß die sinnli‐
chen Triebe im Menschen von Natur aus stark ge‐
nug wirksam sind, und bei gesunden Menschen,
am wenigsten bei Jugendlichen, der besonderen
Aufpeitschung gewiß nicht bedürfen. ‒ ‒
.Jedenfalls nimmt das Kino in dieser Beziehung
keine Ausnahmestellung ein, denn was die
plumpe Absicht, sinnlichen Kitzel zu erregen be‐
lichkeit der Kinodramen für sie durchschaubar
sei, begegnet man einer unbegreiflichen Laxheit
des Urteils. Man glaubt, weil man selbst imstande
ist, ohne seelischen Schaden die albernsten Ab‐
surditäten des Flimmerbildes an sich vorüberzie‐
hen zu sehen, es handle sich im Grunde doch nur
um eine «recht harmlose Sache», denn man kann,
oder mag sich nicht in den Seelenzustand der Ju‐
gendlichen oder des nur bedingt urteilsfähigen
Volkes versetzen, um so die vergiftende Wirkung
der allermeisten Filmspiele zu erkennen. Ich
denke dabei durchaus nicht etwa nur an Darstel‐
lungen, deren ganze Absicht es ist, die Sinne auf‐
zureizen, auch wenn keinerlei Nacktheit, keinerlei
im Sinne der Zensur «unsittliche» Situationen ge‐
zeigt werden, obwohl ich auch wieder in keiner
Weise denen beipflichten kann, die das gröbste
Erregen der Sinnlichkeit beinahe als Kulturzweck
feiern, denn ich bin der Ansicht, daß die sinnli‐
chen Triebe im Menschen von Natur aus stark ge‐
nug wirksam sind, und bei gesunden Menschen,
am wenigsten bei Jugendlichen, der besonderen
Aufpeitschung gewiß nicht bedürfen. ‒ ‒
keine Ausnahmestellung ein, denn was die
plumpe Absicht, sinnlichen Kitzel zu erregen be‐
trifft, so leistet da so manche «Industrie» minde‐
stens Ebenbürtiges, von der Postkarte angefan‐
gen bis zum literarisch tuenden Roman und dem
auf die Börse der Theaterbesucher wie ein
Strauchdieb spekulierenden Schauspielkitsch.
.Viel schlimmer erscheint mir die verheerende
Wirkung der Kinodramen zu sein, durch die Ver‐
logenheit der Darstellungen und ihres Milieus. ‒
.Die Filmindustrie, die letzten Endes für alle
Schäden allein verantwortlich ist, denn der Kino‐
besitzer nimmt, was sie ihm bietet, weil er ja nichts
anderes bekommen kann, tut sich nicht wenig
darauf zugute, so realistisch wie möglich zu arbei‐
ten. Aber man sehe sich diesen «Realismus» ein‐
mal etwas genauer an!
.Wo in aller Welt gibt es soviel Tagediebe wie im
Kinodrama? Wo in aller Welt leben Menschen der
Arbeit, Gelehrte, Erfinder, Kaufleute, Künstler, in
der Art und Weise, wie das Kino ihr Leben zu zei‐
gen vorgibt? ‒ Wo in aller Welt können sich nor‐
mal begüterte Menschen den Luxus des Milieus
leisten, der in diesen Kinodramen immer wieder‐
kehrt? ‒
.Die protzig überladene Wohnung eines Schie‐
bers in Berlin WW, mag er nun seinen Reichtum
stens Ebenbürtiges, von der Postkarte angefan‐
gen bis zum literarisch tuenden Roman und dem
auf die Börse der Theaterbesucher wie ein
Strauchdieb spekulierenden Schauspielkitsch.
Wirkung der Kinodramen zu sein, durch die Ver‐
logenheit der Darstellungen und ihres Milieus. ‒
Schäden allein verantwortlich ist, denn der Kino‐
besitzer nimmt, was sie ihm bietet, weil er ja nichts
anderes bekommen kann, tut sich nicht wenig
darauf zugute, so realistisch wie möglich zu arbei‐
ten. Aber man sehe sich diesen «Realismus» ein‐
mal etwas genauer an!
Kinodrama? Wo in aller Welt leben Menschen der
Arbeit, Gelehrte, Erfinder, Kaufleute, Künstler, in
der Art und Weise, wie das Kino ihr Leben zu zei‐
gen vorgibt? ‒ Wo in aller Welt können sich nor‐
mal begüterte Menschen den Luxus des Milieus
leisten, der in diesen Kinodramen immer wieder‐
kehrt? ‒
bers in Berlin WW, mag er nun seinen Reichtum
vor, im, oder nach dem Krieg «gemacht» haben,
ist doch gewiß nicht der Typus der Wohnung ei‐
nes jeden Begüterten! ‒ Und ebensowenig pfle‐
gen sich Männer und Frauen anständiger, besit‐
zender Kreise in der Art zu kleiden, wie es die
männliche und weibliche Lebewelt der großstäd‐
tischen Nachtlokale liebt, die sich das auf anderer
Leute Kosten leisten kann.
.Was soll der einfache Mann aus dem Volke, der
ohnehin schon mit bitteren Gefühlen von einem
Leben der «Reichen» träumt, wie es höchstens in
seltenen Auswüchsen einmal bei einem Geldprot‐
zen, der aus der Hefe einer Großstadt aufstieg,
zur Wirklichkeit wird, ‒ was soll der Jugendliche,
der aus ärmlichen Verhältnissen kommt, bei sol‐
chen Schilderungen aufnehmen, wenn nicht Haß
und Wut auf alle diese reichen Müßiggänger,
oder, im besten Fall, eine völlig überspannte Vor‐
stellung von dem Leben begüterter Kreise und
angesehener Berufe, und eine ebenso über‐
spannte Sucht, es ihnen nach Möglichkeit bald
gleichtun zu können ?! ‒ ‒ ‒
.Hier steckt meines Erachtens die allerübelste
Wirkung der Kinodramen, übler noch als die Ge‐
schmacksverbildung in literarischem Sinn, und
übler als alle kitschige Erotik. ‒
ist doch gewiß nicht der Typus der Wohnung ei‐
nes jeden Begüterten! ‒ Und ebensowenig pfle‐
gen sich Männer und Frauen anständiger, besit‐
zender Kreise in der Art zu kleiden, wie es die
männliche und weibliche Lebewelt der großstäd‐
tischen Nachtlokale liebt, die sich das auf anderer
Leute Kosten leisten kann.
ohnehin schon mit bitteren Gefühlen von einem
Leben der «Reichen» träumt, wie es höchstens in
seltenen Auswüchsen einmal bei einem Geldprot‐
zen, der aus der Hefe einer Großstadt aufstieg,
zur Wirklichkeit wird, ‒ was soll der Jugendliche,
der aus ärmlichen Verhältnissen kommt, bei sol‐
chen Schilderungen aufnehmen, wenn nicht Haß
und Wut auf alle diese reichen Müßiggänger,
oder, im besten Fall, eine völlig überspannte Vor‐
stellung von dem Leben begüterter Kreise und
angesehener Berufe, und eine ebenso über‐
spannte Sucht, es ihnen nach Möglichkeit bald
gleichtun zu können ?! ‒ ‒ ‒
Wirkung der Kinodramen, übler noch als die Ge‐
schmacksverbildung in literarischem Sinn, und
übler als alle kitschige Erotik. ‒
.Die Wirkung ist um so verderblicher, weil ja das
Kino wirkliches Leben vortäuschen will und von
dem naiven Beschauer auch ohne weiteres als ge‐
naue Darstellung des Lebens, wie es wirklich seiner
Meinung nach ist, genommen wird. Alles spielt ja
in natürlicher Umgebung. Das Leben der Straße
spielt mit, wie es sich gerade trifft, wirkliche Gär‐
ten und Parks, wirkliche Häuser und wirkliche
freie Luft bilden den Hintergrund der Szenen.
Unwillkürlich wird auch die «Wirklichkeit» der
Innenräume, die nicht wie beim Theater, Kulisse
sind, den Eindruck verstärken, man habe es mit
wirklichen Begebnissen zu tun. ‒
.Dazu kommt noch, daß doch die meisten Kino‐
schauspieler und Schauspielerinnen als solche
mehr oder weniger «Talmi» sind, von Ausnahmen
abgesehen, wo sich eine wirkliche Bühnengröße
des Geldverdienstes wegen für das Kino hergibt.
Die allermeisten dieser Akteure stammen gewiß
nicht aus vornehmen Häusern, kennen das Le‐
ben des wirklichen Aristokraten gewiß nicht aus ei‐
gener Anschauung, und so geben sie in ihrer
Rolle eben, was sie geben können: ‒ Talmi und
Kitsch. ‒
.Von der Verlogenheit historischer Milieus oder
ethnographischer Schauplätze und ihrer agieren‐
den Charaktere sei hier nur nebenbei noch die
Kino wirkliches Leben vortäuschen will und von
dem naiven Beschauer auch ohne weiteres als ge‐
naue Darstellung des Lebens, wie es wirklich seiner
Meinung nach ist, genommen wird. Alles spielt ja
in natürlicher Umgebung. Das Leben der Straße
spielt mit, wie es sich gerade trifft, wirkliche Gär‐
ten und Parks, wirkliche Häuser und wirkliche
freie Luft bilden den Hintergrund der Szenen.
Unwillkürlich wird auch die «Wirklichkeit» der
Innenräume, die nicht wie beim Theater, Kulisse
sind, den Eindruck verstärken, man habe es mit
wirklichen Begebnissen zu tun. ‒
schauspieler und Schauspielerinnen als solche
mehr oder weniger «Talmi» sind, von Ausnahmen
abgesehen, wo sich eine wirkliche Bühnengröße
des Geldverdienstes wegen für das Kino hergibt.
Die allermeisten dieser Akteure stammen gewiß
nicht aus vornehmen Häusern, kennen das Le‐
ben des wirklichen Aristokraten gewiß nicht aus ei‐
gener Anschauung, und so geben sie in ihrer
Rolle eben, was sie geben können: ‒ Talmi und
Kitsch. ‒
ethnographischer Schauplätze und ihrer agieren‐
den Charaktere sei hier nur nebenbei noch die
Rede. Auch hier wird alles, was wirklich beleh‐
rend und wertvoll sein könnte, durch eine unsäg‐
lich alberne Aufmachung verdorben, und der oh‐
nehin schon allem Kitsch wohlgeneigte Ge‐
schmack der Menge in geradezu raffinierter
Weise noch unter sein ursprüngliches Niveau her‐
abgedrückt. Das gleiche gilt von den, aller Le‐
benswirklichkeit hohnsprechenden, so sehr be‐
liebten Detektivgeschichten, die noch außerdem
oft geradezu wie «Lehrkurse für Verbrecher und
solche, die es werden wollen», wirken. Es wäre
eine interessante Aufgabe für Kriminalisten, bei
den Verbrechen Jugendlicher, oder sonst Unbe‐
scholtener, einmal nachzuforschen, welcher Pro‐
zentsatz da auf eine «erste Anregung» aus dem
Kino entfällt. ‒ ‒
.Man sieht, es hat gute Gründe, wenn ernste
Männer und Frauen heute mit Sorge das «Kino‐
problem» betrachten, wenn man endlich anfängt
zu sehen, welche verheerende Seuche da mitten
unter uns wütet, und nach Mitteln sucht, sie ein‐
zudämmen. ‒ ‒
.Wie ich schon bemerkte, ist es gänzlich ver‐
kehrt, den Kinobesitzer als den Schädling anzuse‐
hen. Ein solcher Unternehmer würde mit Freu‐
den auch die kulturell wertvollste Einrichtung mit
gleicher Liebe ausgestalten, wenn sie ihm mehr,
rend und wertvoll sein könnte, durch eine unsäg‐
lich alberne Aufmachung verdorben, und der oh‐
nehin schon allem Kitsch wohlgeneigte Ge‐
schmack der Menge in geradezu raffinierter
Weise noch unter sein ursprüngliches Niveau her‐
abgedrückt. Das gleiche gilt von den, aller Le‐
benswirklichkeit hohnsprechenden, so sehr be‐
liebten Detektivgeschichten, die noch außerdem
oft geradezu wie «Lehrkurse für Verbrecher und
solche, die es werden wollen», wirken. Es wäre
eine interessante Aufgabe für Kriminalisten, bei
den Verbrechen Jugendlicher, oder sonst Unbe‐
scholtener, einmal nachzuforschen, welcher Pro‐
zentsatz da auf eine «erste Anregung» aus dem
Kino entfällt. ‒ ‒
Männer und Frauen heute mit Sorge das «Kino‐
problem» betrachten, wenn man endlich anfängt
zu sehen, welche verheerende Seuche da mitten
unter uns wütet, und nach Mitteln sucht, sie ein‐
zudämmen. ‒ ‒
kehrt, den Kinobesitzer als den Schädling anzuse‐
hen. Ein solcher Unternehmer würde mit Freu‐
den auch die kulturell wertvollste Einrichtung mit
gleicher Liebe ausgestalten, wenn sie ihm mehr,
oder auch nur gleichen Gewinn bringen könnte.
.Und wenn heute wirklich gute, wirklich belehrende
Filme überhaupt in so reicher Menge zu haben wä‐
ren wie der überreich angebotene glänzende
Schund, dann würden sich schon heute auch Licht‐
spieltheater finden, deren Programm auch einen
leidlich geschmackvollen, und vor allem verant‐
wortungsbewußten Menschen den Besuch nahele‐
gen könnte.
.Der Kardinalpunkt der ganzen Frage ist die
Filmbeschaffung, und da wieder nur läßt sich etwas
erreichen, wenn ein genügend starker Druck auf
die bestehenden Filmgesellschaften ausgeübt wer‐
den kann, der ihnen die Frage überhaupt erwä‐
genswert erscheinen läßt.
.Bis jetzt «geht» das Geschäft ja auch so. ‒ Wes‐
halb also etwas ändern, wenn der übergroße Teil
des Publikums doch äußerst zufrieden mit dem
Gebotenen ist? ‒ Ohne eine große, über ganz
Deutschland verbreitete Organisation wird sich nie‐
mals die Stimmstärke entwickeln, die kraftvoll ge‐
nug ist, das Ohr dieser Finanzmagnaten aufhor‐
chen zu lassen. Konkurrenzgesellschaften zu
gründen, die «nur Gutes» bringen sollen, halte
ich für völlig verfehlt. Die bestehenden Gesell‐
schaften arbeiten mit einem eingespielten Riesen‐
apparat und mit Riesenkapital. Sie allein werden
Filme überhaupt in so reicher Menge zu haben wä‐
ren wie der überreich angebotene glänzende
Schund, dann würden sich schon heute auch Licht‐
spieltheater finden, deren Programm auch einen
leidlich geschmackvollen, und vor allem verant‐
wortungsbewußten Menschen den Besuch nahele‐
gen könnte.
Filmbeschaffung, und da wieder nur läßt sich etwas
erreichen, wenn ein genügend starker Druck auf
die bestehenden Filmgesellschaften ausgeübt wer‐
den kann, der ihnen die Frage überhaupt erwä‐
genswert erscheinen läßt.
halb also etwas ändern, wenn der übergroße Teil
des Publikums doch äußerst zufrieden mit dem
Gebotenen ist? ‒ Ohne eine große, über ganz
Deutschland verbreitete Organisation wird sich nie‐
mals die Stimmstärke entwickeln, die kraftvoll ge‐
nug ist, das Ohr dieser Finanzmagnaten aufhor‐
chen zu lassen. Konkurrenzgesellschaften zu
gründen, die «nur Gutes» bringen sollen, halte
ich für völlig verfehlt. Die bestehenden Gesell‐
schaften arbeiten mit einem eingespielten Riesen‐
apparat und mit Riesenkapital. Sie allein werden
auch weiterhin diktieren, und ihr Joch ist der
Menge süß. ‒
.Wenn schon die Jugend, hier und an andern Or‐
ten, sich der Kinofrage annahm, so meine ich,
wäre es gar nicht so übel, wenn auch von der Ju‐
gend die Bildung einer machtvollen deutschen Or‐
ganisation zur Umwandlung des Kinos ausginge. ‒
Hier wäre jedenfalls ein ausgiebigerer Erfolg zu
erwarten, als er jemals von den doch recht dane‐
ben hauenden Demonstrationen in Lichtspiel‐
theatern zu erhoffen ist. ‒ An Unterstützung
würde es wahrhaftig nicht fehlen. Ist erst ein An‐
fang gemacht, dann zweifle ich nicht mehr, daß in
ein paar Jahren auch gute Filme in genügender
Menge hergestellt werden, «der Not gehorchend,
nicht dem eignen Trieb», was die Filmgesellschaf‐
ten anlangt.
.Mittlerweile haben hier in Görlitz zwei Männer,
deren Beruf sie in nächsten Konnex mit der Ju‐
gend führt, sehr anerkennenswerte Versuche un‐
ternommen, die Kunst und die Heimatliebe ins
Kino einzuführen. Als Bereicherung der Möglich‐
keiten, die ein Lichtspieltheater bieten kann, sind
diese Versuche sehr begrüßenswert, wenn sie auch
zur eigentlichen Lösung der Kinofrage, die eine
Filmfrage ist, nur mittelbar beitragen. Die durch
seine Bemühungen gebotene Gelegenheit, hier
Menge süß. ‒
ten, sich der Kinofrage annahm, so meine ich,
wäre es gar nicht so übel, wenn auch von der Ju‐
gend die Bildung einer machtvollen deutschen Or‐
ganisation zur Umwandlung des Kinos ausginge. ‒
Hier wäre jedenfalls ein ausgiebigerer Erfolg zu
erwarten, als er jemals von den doch recht dane‐
ben hauenden Demonstrationen in Lichtspiel‐
theatern zu erhoffen ist. ‒ An Unterstützung
würde es wahrhaftig nicht fehlen. Ist erst ein An‐
fang gemacht, dann zweifle ich nicht mehr, daß in
ein paar Jahren auch gute Filme in genügender
Menge hergestellt werden, «der Not gehorchend,
nicht dem eignen Trieb», was die Filmgesellschaf‐
ten anlangt.
deren Beruf sie in nächsten Konnex mit der Ju‐
gend führt, sehr anerkennenswerte Versuche un‐
ternommen, die Kunst und die Heimatliebe ins
Kino einzuführen. Als Bereicherung der Möglich‐
keiten, die ein Lichtspieltheater bieten kann, sind
diese Versuche sehr begrüßenswert, wenn sie auch
zur eigentlichen Lösung der Kinofrage, die eine
Filmfrage ist, nur mittelbar beitragen. Die durch
seine Bemühungen gebotene Gelegenheit, hier
schwer zugängliche Klingersche Radierungen im
Lichtbild sehen zu können, sichert Hrn. Oberlehrer
Schulze, neben den hochinteressanten Ausführun‐
gen seines Vortrages, stets gut besuchte Häuser,
zumal er sich an Erwachsene wendet, unter denen
hier immerhin eine ziemliche Anzahl Kunstinter‐
essenten zu finden ist. Weniger Verständnis zeigt
sich, wenigstens vorläufig, für die schönen Nach‐
mittagsvorträge, in denen Hr. Zeichenlehrer Haupt
der Jugend seinen reichen Schatz an eigenen Auf‐
nahmen aus der Heimat darbietet, und ihr,
gleichsam nebenbei, eine Fülle des Interessanten
und Belehrenden aus der Heimatgeschichte, die
er so genau kennt, übermittelt. Es wäre außeror‐
dentlich zu bedauern, wenn diese vom Geist ech‐
ter Heimatliebe und freudigen Gebenwollens ge‐
tragene Veranstaltung aus «Mangel an Interesse»
aufgegeben werden müßte. Wenn Eltern sich
selbst und ihren Kindern eine Stunde gediegenen
Genusses bereiten wollen, so können sie nichts
Besseres tun, als diese Vorträge des Hrn. Haupt
zu besuchen.
.Immerhin, so anziehend und belehrend die
Vorträge beider Herren auch sind, so sehe ich in
ihnen, obwohl zwar Hr. Haupt, der Jugend Rech‐
nung tragend, auch das Kino mit humorvollen,
einwandfreien oder auch belehrenden Filmnum‐
Lichtbild sehen zu können, sichert Hrn. Oberlehrer
Schulze, neben den hochinteressanten Ausführun‐
gen seines Vortrages, stets gut besuchte Häuser,
zumal er sich an Erwachsene wendet, unter denen
hier immerhin eine ziemliche Anzahl Kunstinter‐
essenten zu finden ist. Weniger Verständnis zeigt
sich, wenigstens vorläufig, für die schönen Nach‐
mittagsvorträge, in denen Hr. Zeichenlehrer Haupt
der Jugend seinen reichen Schatz an eigenen Auf‐
nahmen aus der Heimat darbietet, und ihr,
gleichsam nebenbei, eine Fülle des Interessanten
und Belehrenden aus der Heimatgeschichte, die
er so genau kennt, übermittelt. Es wäre außeror‐
dentlich zu bedauern, wenn diese vom Geist ech‐
ter Heimatliebe und freudigen Gebenwollens ge‐
tragene Veranstaltung aus «Mangel an Interesse»
aufgegeben werden müßte. Wenn Eltern sich
selbst und ihren Kindern eine Stunde gediegenen
Genusses bereiten wollen, so können sie nichts
Besseres tun, als diese Vorträge des Hrn. Haupt
zu besuchen.
Vorträge beider Herren auch sind, so sehe ich in
ihnen, obwohl zwar Hr. Haupt, der Jugend Rech‐
nung tragend, auch das Kino mit humorvollen,
einwandfreien oder auch belehrenden Filmnum‐
mern heranzieht, nur eine Bereicherung des im
Lichtspieltheater möglichen Programms, denn wie
die Dinge heute liegen, hat das Stehbild im «Kino»,
wie schon der Name sagt, doch nur sekundäre Be‐
deutung. Man kommt in erster Linie, um bewegtes
Leben auf der Leinwand zu sehen. Daß dieses be‐
wegte Leben eminent bedeutend, belehrend, er‐
heiternd, und in höchstem Grade interessant sein
kann, ohne verderblich zu wirken, steht außer
Frage. Aber die prächtigen Möglichkeiten des
Filmbildes, das uns alle Wunder der Märchenwelt
als Wirklichkeit schauen lassen, und die tiefste ur‐
sprüngliche Poesie vermitteln kann, werden nie‐
mals in einer andern, als der dem Berliner Nacht‐
kaffeehaus angepaßten Weise ausgenützt werden,
wenn sich nicht in ganz Deutschland eine achtung‐
gebietende Anzahl von Männern und Frauen fin‐
det (die männliche und weibliche Jugend rechne
ich hier in erster Linie dazu), die wenigstens un‐
sern deutschen Filmgesellschaften einmal mit aller
Deutlichkeit sagen, wie das deutsche Volk die an
sich so wunderbare Erfindung des beweglichen
Lichtbildes verwertet wissen will...
Lichtspieltheater möglichen Programms, denn wie
die Dinge heute liegen, hat das Stehbild im «Kino»,
wie schon der Name sagt, doch nur sekundäre Be‐
deutung. Man kommt in erster Linie, um bewegtes
Leben auf der Leinwand zu sehen. Daß dieses be‐
wegte Leben eminent bedeutend, belehrend, er‐
heiternd, und in höchstem Grade interessant sein
kann, ohne verderblich zu wirken, steht außer
Frage. Aber die prächtigen Möglichkeiten des
Filmbildes, das uns alle Wunder der Märchenwelt
als Wirklichkeit schauen lassen, und die tiefste ur‐
sprüngliche Poesie vermitteln kann, werden nie‐
mals in einer andern, als der dem Berliner Nacht‐
kaffeehaus angepaßten Weise ausgenützt werden,
wenn sich nicht in ganz Deutschland eine achtung‐
gebietende Anzahl von Männern und Frauen fin‐
det (die männliche und weibliche Jugend rechne
ich hier in erster Linie dazu), die wenigstens un‐
sern deutschen Filmgesellschaften einmal mit aller
Deutlichkeit sagen, wie das deutsche Volk die an
sich so wunderbare Erfindung des beweglichen
Lichtbildes verwertet wissen will...
ES sind jetzt etwa fünfzehn Jahre her, seit ich
zum erstenmal die Hand des nun Verbliche‐
nen in der meinen halten durfte. Damals, in sei‐
ner Leipziger Villa, kam er mir, von dem er durch
Freunde gehört hatte, zuerst recht feierlich ent‐
gegen, aber das legte sich bei späteren Begegnun‐
gen, als wir uns genügend kennengelernt hatten,
ganz von selbst, so daß, wenn ich heute an Klinger
denke, nur immer das Bild eines Mannes vor mir
steht, mächtig und bedeutend schon in seiner
äußeren Erscheinung, aber nur mit Hose und Fi‐
letnetzjacke bekleidet, und darüber dieser un‐
glaublich kluge Kopf mit dem rotblonden Haar‐
schopf und dem gleichgefärbten Knebelbart. Die
Art, in der er einen so über die Brillengläser weg
anschauen konnte, war ganz unbeschreiblich fas‐
zinierend, und ich glaube gerne, daß diesem Blick
nicht jeder standzuhalten vermochte. Wie er mir
zwischen den Modellen und Vorarbeiten im Ate‐
lier und abends beim Wein erzählte, war er auch
von Natur aus sehr unzugänglich und konnte
zum erstenmal die Hand des nun Verbliche‐
nen in der meinen halten durfte. Damals, in sei‐
ner Leipziger Villa, kam er mir, von dem er durch
Freunde gehört hatte, zuerst recht feierlich ent‐
gegen, aber das legte sich bei späteren Begegnun‐
gen, als wir uns genügend kennengelernt hatten,
ganz von selbst, so daß, wenn ich heute an Klinger
denke, nur immer das Bild eines Mannes vor mir
steht, mächtig und bedeutend schon in seiner
äußeren Erscheinung, aber nur mit Hose und Fi‐
letnetzjacke bekleidet, und darüber dieser un‐
glaublich kluge Kopf mit dem rotblonden Haar‐
schopf und dem gleichgefärbten Knebelbart. Die
Art, in der er einen so über die Brillengläser weg
anschauen konnte, war ganz unbeschreiblich fas‐
zinierend, und ich glaube gerne, daß diesem Blick
nicht jeder standzuhalten vermochte. Wie er mir
zwischen den Modellen und Vorarbeiten im Ate‐
lier und abends beim Wein erzählte, war er auch
von Natur aus sehr unzugänglich und konnte
eine gewisse «Schüchternheit», wie er es selbst
nannte, nur sehr schwer überwinden.
.So viel auch über seine Kunst geschrieben wor‐
den ist, ‒ den Menschen Klinger fand ich bis jetzt
noch niemals gehörig gewürdigt. Man konnte
glauben, er lebe in unserer Zeit, und entdeckte
dann plötzlich, daß man einen vornehmen Rö‐
mer, vielleicht auch einen Griechen der hellenisti‐
schen Zeit vor sich hatte, ‒ ‒ man war versucht,
ihn als einen Spätgeborenen, oder als eine Rein‐
karnation der Antike zu nehmen, und sah ebenso
überraschend stark ausgeprägt einen Menschen
vor sich, der gesättigt war mit allen Werten mo‐
derner Kultur... Musikalisch bis in die Finger‐
spitzen, belesen wie ein moderner Literatur- und
Theaterkritiker, völlig vertraut mit dem Leben
der großen Welt, und dabei so unendlich kindlich
einfach in mancher Urteilsbildung, daß man sich
hätte verwirren lassen können, wenn man auch
nur einen Moment vergessen hätte, was alles die‐
ser mächtige und doch so kompliziert gebildete
Schädel barg. Man hat Klinger oft genug ein
Übermaß an Intelligenz vorgeworfen, einer Intel‐
ligenz, die angeblich seiner Kunst im Wege stehen
sollte, aber wer ihn jemals so kennen lernen
durfte, wie es mir vergönnt war, der wird mir
gerne bestätigen, daß in diesem modernen Pan
nannte, nur sehr schwer überwinden.
den ist, ‒ den Menschen Klinger fand ich bis jetzt
noch niemals gehörig gewürdigt. Man konnte
glauben, er lebe in unserer Zeit, und entdeckte
dann plötzlich, daß man einen vornehmen Rö‐
mer, vielleicht auch einen Griechen der hellenisti‐
schen Zeit vor sich hatte, ‒ ‒ man war versucht,
ihn als einen Spätgeborenen, oder als eine Rein‐
karnation der Antike zu nehmen, und sah ebenso
überraschend stark ausgeprägt einen Menschen
vor sich, der gesättigt war mit allen Werten mo‐
derner Kultur... Musikalisch bis in die Finger‐
spitzen, belesen wie ein moderner Literatur- und
Theaterkritiker, völlig vertraut mit dem Leben
der großen Welt, und dabei so unendlich kindlich
einfach in mancher Urteilsbildung, daß man sich
hätte verwirren lassen können, wenn man auch
nur einen Moment vergessen hätte, was alles die‐
ser mächtige und doch so kompliziert gebildete
Schädel barg. Man hat Klinger oft genug ein
Übermaß an Intelligenz vorgeworfen, einer Intel‐
ligenz, die angeblich seiner Kunst im Wege stehen
sollte, aber wer ihn jemals so kennen lernen
durfte, wie es mir vergönnt war, der wird mir
gerne bestätigen, daß in diesem modernen Pan
auch eine Gefühlstiefe wurzelte, wie sie, selbst un‐
ter den hervorragendsten Meistern der Kunst ‒
sehr selten ist. Ich glaube, daß man wirklich bis
zu den Gestalten der Antike, bis zu griechischen
Vasenmalern, oder mindestens zu den hervor‐
ragendsten Persönlichkeiten der italienischen
Renaissance zurückgreifen muß, wenn man
irgendwo in einem Menschen diese kraftstrot‐
zende und doch so hochkultivierte Sinnlichkeit
wiederfinden will, die eigentlich Klingers künst‐
lerisches Fundament war. Ihm war das ganze Er‐
dendasein Ausdruck göttlicher Sinnenfreude, und er
glaubte an seine sinnlich-frohen «Heidengötter»,
wie Schwind an seine Gnomen und Elfen glaubte,
mit der ganzen Inbrunst eines Herzens, dem es
Selbstverständlichkeit ist, daß «die Sonne Homers»
auch unserem Geschlechte scheint, wenn es ‒ ihrer
würdig ist, wie er es war. ‒ ‒ ‒
.Die neuere Kunstentwicklung hat anscheinend
Klinger überholt, aber niemand begrüßte das so,
wie Klinger selbst. ‒ Er wollte keine «Schule ma‐
chen». Er wußte viel zu genau, daß er ein Einzigar‐
tiger war, dem keiner ohne Gefahr nachfolgen
durfte. Nichts brachte ihn, nach eigenem Geständ‐
nis, mehr zur Verstimmung, als wenn er sah, daß
irgendein junger Künstler auf seinen Fuß-Spu‐
ren zur Kunst zu gelangen suchte. Wie groß aber
ter den hervorragendsten Meistern der Kunst ‒
sehr selten ist. Ich glaube, daß man wirklich bis
zu den Gestalten der Antike, bis zu griechischen
Vasenmalern, oder mindestens zu den hervor‐
ragendsten Persönlichkeiten der italienischen
Renaissance zurückgreifen muß, wenn man
irgendwo in einem Menschen diese kraftstrot‐
zende und doch so hochkultivierte Sinnlichkeit
wiederfinden will, die eigentlich Klingers künst‐
lerisches Fundament war. Ihm war das ganze Er‐
dendasein Ausdruck göttlicher Sinnenfreude, und er
glaubte an seine sinnlich-frohen «Heidengötter»,
wie Schwind an seine Gnomen und Elfen glaubte,
mit der ganzen Inbrunst eines Herzens, dem es
Selbstverständlichkeit ist, daß «die Sonne Homers»
auch unserem Geschlechte scheint, wenn es ‒ ihrer
würdig ist, wie er es war. ‒ ‒ ‒
Klinger überholt, aber niemand begrüßte das so,
wie Klinger selbst. ‒ Er wollte keine «Schule ma‐
chen». Er wußte viel zu genau, daß er ein Einzigar‐
tiger war, dem keiner ohne Gefahr nachfolgen
durfte. Nichts brachte ihn, nach eigenem Geständ‐
nis, mehr zur Verstimmung, als wenn er sah, daß
irgendein junger Künstler auf seinen Fuß-Spu‐
ren zur Kunst zu gelangen suchte. Wie groß aber
war seine Freude, wenn er irgendwo einen fand,
der neue Wege suchte. Nur seine übergroße
Ängstlichkeit vor jeder Zeitungsnotiz konnte ihn
dann davon abhalten, für einen Neuerer öffent‐
lich einzutreten. Ich selbst hatte ihm seinerzeit
Arbeiten gezeigt, zum Teil symbolischen und spä‐
ter rein farbensymbolischen* Inhaltes, die man
heute wohl zum «Expressionismus» rechnen
würde, und ich werde niemals vergessen, wie er
mir mal bis zum Gartentor nachlief, um mir noch‐
mals einzuschärfen, ich möchte mich doch ja
durch Ablehnung nicht «decouragieren» lassen.
Daß ich dennoch nur mit zwei Mappenwerken
rein symbolistischen Inhalts damals in die Öffent‐
lichkeit zu treten wagte und mit meinen farben‐
symbolischen Werken mich nicht bemerkbar
machte, hat er mir, wie ich bei meinem letzten Be‐
such sah, beinahe als Charakterfehler angerech‐
net, obwohl ich ihm damals wenigstens die Photo‐
graphien meiner griechischen Bilder zeigen
konnte, die ihn, den begeisterten Freund Grie‐
chenlands und seiner antiken Überreste, gerade
deshalb am meisten erfreuten, weil er auf keinem
der Bilder Anklänge an die heutige Zeit entdeckte. ‒
der neue Wege suchte. Nur seine übergroße
Ängstlichkeit vor jeder Zeitungsnotiz konnte ihn
dann davon abhalten, für einen Neuerer öffent‐
lich einzutreten. Ich selbst hatte ihm seinerzeit
Arbeiten gezeigt, zum Teil symbolischen und spä‐
ter rein farbensymbolischen* Inhaltes, die man
heute wohl zum «Expressionismus» rechnen
würde, und ich werde niemals vergessen, wie er
mir mal bis zum Gartentor nachlief, um mir noch‐
mals einzuschärfen, ich möchte mich doch ja
durch Ablehnung nicht «decouragieren» lassen.
Daß ich dennoch nur mit zwei Mappenwerken
rein symbolistischen Inhalts damals in die Öffent‐
lichkeit zu treten wagte und mit meinen farben‐
symbolischen Werken mich nicht bemerkbar
machte, hat er mir, wie ich bei meinem letzten Be‐
such sah, beinahe als Charakterfehler angerech‐
net, obwohl ich ihm damals wenigstens die Photo‐
graphien meiner griechischen Bilder zeigen
konnte, die ihn, den begeisterten Freund Grie‐
chenlands und seiner antiken Überreste, gerade
deshalb am meisten erfreuten, weil er auf keinem
der Bilder Anklänge an die heutige Zeit entdeckte. ‒
* Die «farbensymbolischen Werke» bzw. «farbig-abstrak‐ 00
ten Gebilde» wurden später von Bô Yin Râ als «geistliche 00
Bilder» bezeichnet.
ten Gebilde» wurden später von Bô Yin Râ als «geistliche 00
Bilder» bezeichnet.
.Immer und immer wieder aber kam er auf die
früheren farbensymbolischen Arbeiten zurück
und bedauerte, daß ich den Mut nicht fand, sie
der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich war mir jedoch
nur viel zu klar darüber, daß eben nur Klinger, mit
seinem unglaublich ausgebildeten Musikempfin‐
den, dazu imstande war, das zu erfühlen, was ich
da in Farben-Rhythmen für mich selbst auszuspre‐
chen unternommen hatte, aber ich bedauere tief,
daß ich ihm die letzte Freude nicht mehr bereiten
konnte, ihm zu sagen und zu zeigen, wie der
Drang zu farbig-abstrakten Gebilden mich wieder
erfaßte, und wie er schließlich, nachdem das Er‐
lebnis «Griechenland» Gestalt gewonnen hatte, zu
neuen Resultaten führte. ‒ Immer wieder klagte
er mir, daß man ihn nicht in Ruhe ließe, und wie
Unzählige, meist seiner Ansicht nach völlig Un‐
berufene, von ihm «ein Urteil» haben wollten, be‐
sonders Graphiker. Hier war es nun seine Schwä‐
che, daß er es niemals fertig brachte, rücksichtslos
seine Meinung zu sagen... Für jeden, mochte er
auch noch so unbedeutend sein, hatte er ein lie‐
benswürdiges Wort, auch wenn er nachher dort,
wo er sich geben durfte, wie er war, kopfschüt‐
telnd seine sarkastischen Bemerkungen machte
über die «unglaubliche Borniertheit» der Kerle,
die da «die schönen Kupferplatten zuschanden»
arbeiteten. ‒
früheren farbensymbolischen Arbeiten zurück
und bedauerte, daß ich den Mut nicht fand, sie
der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich war mir jedoch
nur viel zu klar darüber, daß eben nur Klinger, mit
seinem unglaublich ausgebildeten Musikempfin‐
den, dazu imstande war, das zu erfühlen, was ich
da in Farben-Rhythmen für mich selbst auszuspre‐
chen unternommen hatte, aber ich bedauere tief,
daß ich ihm die letzte Freude nicht mehr bereiten
konnte, ihm zu sagen und zu zeigen, wie der
Drang zu farbig-abstrakten Gebilden mich wieder
erfaßte, und wie er schließlich, nachdem das Er‐
lebnis «Griechenland» Gestalt gewonnen hatte, zu
neuen Resultaten führte. ‒ Immer wieder klagte
er mir, daß man ihn nicht in Ruhe ließe, und wie
Unzählige, meist seiner Ansicht nach völlig Un‐
berufene, von ihm «ein Urteil» haben wollten, be‐
sonders Graphiker. Hier war es nun seine Schwä‐
che, daß er es niemals fertig brachte, rücksichtslos
seine Meinung zu sagen... Für jeden, mochte er
auch noch so unbedeutend sein, hatte er ein lie‐
benswürdiges Wort, auch wenn er nachher dort,
wo er sich geben durfte, wie er war, kopfschüt‐
telnd seine sarkastischen Bemerkungen machte
über die «unglaubliche Borniertheit» der Kerle,
die da «die schönen Kupferplatten zuschanden»
arbeiteten. ‒
.Über sein eigenes Werk, seine Radierungs‐
Zyklen, seine Plastik und seine Malerei auch nur
ein Wort zu verlieren, hieße «Eulen nach Athen
tragen». (Obwohl ich in dem heutigen Athen
recht wenig Eulenrufe hörte!) Er war ein durch‐
aus Einziger und Unnachahmlicher, eine der ganz
großen Persönlichkeiten, die man nur würdigen
kann, wenn man das Glück hatte, ihnen persön‐
lich nahekommen zu dürfen, die aber erst von der
Nachwelt ihre feste und unverrückbare Stellung
im Pantheon der Großen eines Volkes erhalten. ‒
.Erschütternd wirkt sein Scheiden doppelt in
diesen schicksalsschweren Tagen, und dennoch
hatte ich niemals bei ihm das Gefühl, daß dieses
starke Leben einst zu einem Patriarchenalter füh‐
ren könne. Der ganze Mensch wirkte wie ein
Fragment einer überweltlichen Architektur, und
als ein solcher sollte er wohl auch seiner Nachwelt
erkennbar werden. ‒ ‒ Was Rodin für Frankreich
war, und dennoch zugleich für die ganze Welt, ‒ das
war Max Klinger für uns, und vielleicht ‒ ‒ auch für
einen gar nicht so unbeträchtlichen Teil der außer‐
deutschen Welt. ‒
Zyklen, seine Plastik und seine Malerei auch nur
ein Wort zu verlieren, hieße «Eulen nach Athen
tragen». (Obwohl ich in dem heutigen Athen
recht wenig Eulenrufe hörte!) Er war ein durch‐
aus Einziger und Unnachahmlicher, eine der ganz
großen Persönlichkeiten, die man nur würdigen
kann, wenn man das Glück hatte, ihnen persön‐
lich nahekommen zu dürfen, die aber erst von der
Nachwelt ihre feste und unverrückbare Stellung
im Pantheon der Großen eines Volkes erhalten. ‒
diesen schicksalsschweren Tagen, und dennoch
hatte ich niemals bei ihm das Gefühl, daß dieses
starke Leben einst zu einem Patriarchenalter füh‐
ren könne. Der ganze Mensch wirkte wie ein
Fragment einer überweltlichen Architektur, und
als ein solcher sollte er wohl auch seiner Nachwelt
erkennbar werden. ‒ ‒ Was Rodin für Frankreich
war, und dennoch zugleich für die ganze Welt, ‒ das
war Max Klinger für uns, und vielleicht ‒ ‒ auch für
einen gar nicht so unbeträchtlichen Teil der außer‐
deutschen Welt. ‒
KÜRZLICH war in einer Zeitungsnotiz zu le‐
sen, daß Edison sich mit der Konstruktion ei‐
nes hochsensiblen Apparats befasse, der es den
Seelen Abgeschiedener, falls sie die von überzeu‐
gungstreuen Spiritisten angenommene Sehn‐
sucht verspürten, mit den auf Erden Zurückge‐
bliebenen zu verkehren, sehr wesentlich erleich‐
tern solle, sich bemerkbar zu machen.
.Gleichzeitig hofft Edison, wie er angeblich ei‐
nen amerikanischen Reporter wissen ließ, durch
seinen Apparat endgültig festzustellen, ob der Zu‐
stand der Menschengeister nach dem Tode des
Körpers überhaupt zu einer solchen Kommuni‐
kation fähig, oder ob alle mit Hilfe von Medien er‐
haltenen Botschaften nur eitle Flunkerei seien.
Jedenfalls traut er, nach dem Bericht, den Medien
nicht viel Gutes zu.
.Es ist ebensowohl denkbar, daß diese Notiz als
fette Ente über den Ozean geflogen kam, wie es
sen, daß Edison sich mit der Konstruktion ei‐
nes hochsensiblen Apparats befasse, der es den
Seelen Abgeschiedener, falls sie die von überzeu‐
gungstreuen Spiritisten angenommene Sehn‐
sucht verspürten, mit den auf Erden Zurückge‐
bliebenen zu verkehren, sehr wesentlich erleich‐
tern solle, sich bemerkbar zu machen.
nen amerikanischen Reporter wissen ließ, durch
seinen Apparat endgültig festzustellen, ob der Zu‐
stand der Menschengeister nach dem Tode des
Körpers überhaupt zu einer solchen Kommuni‐
kation fähig, oder ob alle mit Hilfe von Medien er‐
haltenen Botschaften nur eitle Flunkerei seien.
Jedenfalls traut er, nach dem Bericht, den Medien
nicht viel Gutes zu.
fette Ente über den Ozean geflogen kam, wie es
auch durchaus zu verstehen wäre, daß ein bedeu‐
tender Erfinder das Problem des Verkehrs mit
den Jenseitigen auf seine Weise zu lösen versu‐
chen würde. Eine andere Frage aber ist es, ob je‐
mals durch Apparate die Existenz jenseitiger Intel‐
ligenzen (die trotz ihrer eigenen Behauptungen
durchaus keine verstorbenen Menschen zu sein
brauchen) überhaupt nachgewiesen werden
kann.
.An Apparaten, die den Jenseitigen die Arbeit
erleichtern sollten, hat es bis jetzt durchaus nicht
gefehlt, und es gibt sogar einen Apparat, der an‐
geblich die Medien überflüssig macht (das Arnold‐
sche Skriptoskop) und mit den minimalen Kräften
medialer Art rechnet, die in jedem Menschen
schlummern. Aber alle diese Apparate brauchen
dennoch die Mitwirkung der im sichtbaren Kör‐
per lebenden Menschen. Immer ist die Berührung
des Apparates gebotene Bedingung, soll er über‐
haupt in Bewegung geraten. Ich nehme an, daß
Edison, falls die Notiz auf Wahrheit beruht, an der
Konstruktion eines Apparats arbeitet, der diese
Fehlerquelle ausscheiden will, und ohne jegliche
Berührung von seiten der Experimentatoren, le‐
diglich durch Kraftanwendung, die von unsicht‐
baren Agenten ausgeht, deren Dasein erweisen
soll.
tender Erfinder das Problem des Verkehrs mit
den Jenseitigen auf seine Weise zu lösen versu‐
chen würde. Eine andere Frage aber ist es, ob je‐
mals durch Apparate die Existenz jenseitiger Intel‐
ligenzen (die trotz ihrer eigenen Behauptungen
durchaus keine verstorbenen Menschen zu sein
brauchen) überhaupt nachgewiesen werden
kann.
erleichtern sollten, hat es bis jetzt durchaus nicht
gefehlt, und es gibt sogar einen Apparat, der an‐
geblich die Medien überflüssig macht (das Arnold‐
sche Skriptoskop) und mit den minimalen Kräften
medialer Art rechnet, die in jedem Menschen
schlummern. Aber alle diese Apparate brauchen
dennoch die Mitwirkung der im sichtbaren Kör‐
per lebenden Menschen. Immer ist die Berührung
des Apparates gebotene Bedingung, soll er über‐
haupt in Bewegung geraten. Ich nehme an, daß
Edison, falls die Notiz auf Wahrheit beruht, an der
Konstruktion eines Apparats arbeitet, der diese
Fehlerquelle ausscheiden will, und ohne jegliche
Berührung von seiten der Experimentatoren, le‐
diglich durch Kraftanwendung, die von unsicht‐
baren Agenten ausgeht, deren Dasein erweisen
soll.
.Der Nachricht zufolge erwartet Edison eine
«furchtbare Sensation», falls sein Apparat Erfolg
haben sollte. ‒ ‒
.Nun mag ja gewiß zugegeben werden, daß es
völligen Außenseitern vielleicht sehr imponieren
würde, wenn sie unter dem neuen Apparat plötz‐
lich in sauberer Schreibmaschinenschrift eine
Mitteilung aus dem Jenseits vorfänden, ohne daß
eine Möglichkeit der Mitwirkung sichtbarer Men‐
schen dabei in Betracht kommen könnte. Neu
wäre aber dabei allein die Form des Experiments,
denn die Geschichte des Spiritismus kennt längst
weit eindrucksvollere Geschehnisse, die sich nicht
nur ohne Berührung irgendeines Apparats, son‐
dern völlig ohne besonderen Apparat ereigneten
und mehr als hinlänglich beglaubigt sind. Immer
aber ist die Nähe eines seiner medianimen Bega‐
bung bewußten oder nicht bewußten «Mediums»,
also eines Menschen von abnormer psycho-physi‐
scher Beschaffenheit, Vorausbedingung solcher
Geschehnisse. Was dagegen bei der Beschäfti‐
gung mit Apparaten, die angeblich keines Medi‐
ums bedürfen, herauskommt, ist so wenig über‐
zeugend, läßt sich so leicht auf unbewußte Bewe‐
gung kleinster Muskeln der den Apparat Bedie‐
nenden zurückführen, daß nur völlige Kritiklo‐
sigkeit hier den Beweis für ein jenseitiges Eingrei‐
«furchtbare Sensation», falls sein Apparat Erfolg
haben sollte. ‒ ‒
völligen Außenseitern vielleicht sehr imponieren
würde, wenn sie unter dem neuen Apparat plötz‐
lich in sauberer Schreibmaschinenschrift eine
Mitteilung aus dem Jenseits vorfänden, ohne daß
eine Möglichkeit der Mitwirkung sichtbarer Men‐
schen dabei in Betracht kommen könnte. Neu
wäre aber dabei allein die Form des Experiments,
denn die Geschichte des Spiritismus kennt längst
weit eindrucksvollere Geschehnisse, die sich nicht
nur ohne Berührung irgendeines Apparats, son‐
dern völlig ohne besonderen Apparat ereigneten
und mehr als hinlänglich beglaubigt sind. Immer
aber ist die Nähe eines seiner medianimen Bega‐
bung bewußten oder nicht bewußten «Mediums»,
also eines Menschen von abnormer psycho-physi‐
scher Beschaffenheit, Vorausbedingung solcher
Geschehnisse. Was dagegen bei der Beschäfti‐
gung mit Apparaten, die angeblich keines Medi‐
ums bedürfen, herauskommt, ist so wenig über‐
zeugend, läßt sich so leicht auf unbewußte Bewe‐
gung kleinster Muskeln der den Apparat Bedie‐
nenden zurückführen, daß nur völlige Kritiklo‐
sigkeit hier den Beweis für ein jenseitiges Eingrei‐
fen erblicken kann, selbst wenn der Inhalt der auf
solche Weise erhaltenen Mitteilungen scheinbar
zwingend auf jenseitige Urheber schließen lassen
mag.
.Wird nun Edisons Apparat die Mitwirkung ei‐
nes menschlichen Mediums tatsächlich völlig ent‐
behrlich machen? Wird man, von einem Ausflug
zurückkehrend, plötzlich vor der Tatsache ste‐
hen, daß im sicher verschlossenen Zimmer, in
dem der Apparat stand, eine «Mitteilung aus dem
Jenseits» zustande kam? ‒ Ich glaube kaum, und
mein Zweifel gründet sich dabei denn doch auf ei‐
nigermaßen erprobte Untersuchung der in Be‐
tracht kommenden Faktoren.
.Aber nehmen wir ruhig einmal an, es gelänge
Edison, das «Medium» völlig zu eliminieren und
auf diese Weise völlig einwandfreie Botschaften
aus dem Unsichtbaren zu erhalten. Was wäre da‐
bei gewonnen? ‒ ‒
.Erhalten nicht unsere Telefunkenstationen tag‐
täglich unzählige solcher Botschaften? Allerdings
kennt man da den Absender und weiß, daß es ein
in der Sichtbarkeit lebender Mensch ist. Bei dem
Edisonschen Apparat würde man nun bestenfalls
vielleicht Botschaften erhalten, wie sie der Spiri‐
tismus allerdings längst schon kennt, Botschaften,
solche Weise erhaltenen Mitteilungen scheinbar
zwingend auf jenseitige Urheber schließen lassen
mag.
nes menschlichen Mediums tatsächlich völlig ent‐
behrlich machen? Wird man, von einem Ausflug
zurückkehrend, plötzlich vor der Tatsache ste‐
hen, daß im sicher verschlossenen Zimmer, in
dem der Apparat stand, eine «Mitteilung aus dem
Jenseits» zustande kam? ‒ Ich glaube kaum, und
mein Zweifel gründet sich dabei denn doch auf ei‐
nigermaßen erprobte Untersuchung der in Be‐
tracht kommenden Faktoren.
Edison, das «Medium» völlig zu eliminieren und
auf diese Weise völlig einwandfreie Botschaften
aus dem Unsichtbaren zu erhalten. Was wäre da‐
bei gewonnen? ‒ ‒
täglich unzählige solcher Botschaften? Allerdings
kennt man da den Absender und weiß, daß es ein
in der Sichtbarkeit lebender Mensch ist. Bei dem
Edisonschen Apparat würde man nun bestenfalls
vielleicht Botschaften erhalten, wie sie der Spiri‐
tismus allerdings längst schon kennt, Botschaften,
deren Urheber sich als der Geist Goethes, Napo‐
leons, als «Erzengel Gabriel» oder gar als «Gott‐
Vater» ausgeben würde. Man wäre nach wie vor
auf die Glaubwürdigkeit der sich manifestierenden
Intelligenz angewiesen, und daß es mit dieser
Glaubwürdigkeit dann doch eine recht eigenar‐
tige Bewandtnis hat, das werden selbst unter den
Spiritisten nur jene nicht zugeben wollen, die in
der Offenbarung ihrer «Geister» ein unantast‐
bares Evangelium sehen. Wir würden also nur
zum tausendstenmal die längst erwiesene Tatsa‐
che feststellen können, die auch der Physiker
Crookes nach unzähligen Experimenten (zum Teil
ausgeführt unter Zuhilfenahme der empfindlich‐
sten elektrischen Kontrollapparate) feststellte,
daß es unzweifelhaft unsichtbare Intelligenzen gibt,
die sich physikalisch manifestieren können, daß sie
sich selbst alle möglichen Namen beilegen, daß
aber jeder zwingende Beweis fehlt, der sie als
überlebende geistige Individualitäten «gestorbe‐
ner» Erdenmenschen dartun würde. ‒ Es ist und
bleibt reine Glaubenssache, ob man sie als solche
ansehen mag oder nicht. ‒ ‒
.Wie aber wäre es, wenn man die Hypothese,
daß man es, ihren eigenen Angaben nach, hier
mit «Geistern Verstorbener» zu tun habe, einmal
gänzlich fallen lassen wollte, besonders, da die post‐
leons, als «Erzengel Gabriel» oder gar als «Gott‐
Vater» ausgeben würde. Man wäre nach wie vor
auf die Glaubwürdigkeit der sich manifestierenden
Intelligenz angewiesen, und daß es mit dieser
Glaubwürdigkeit dann doch eine recht eigenar‐
tige Bewandtnis hat, das werden selbst unter den
Spiritisten nur jene nicht zugeben wollen, die in
der Offenbarung ihrer «Geister» ein unantast‐
bares Evangelium sehen. Wir würden also nur
zum tausendstenmal die längst erwiesene Tatsa‐
che feststellen können, die auch der Physiker
Crookes nach unzähligen Experimenten (zum Teil
ausgeführt unter Zuhilfenahme der empfindlich‐
sten elektrischen Kontrollapparate) feststellte,
daß es unzweifelhaft unsichtbare Intelligenzen gibt,
die sich physikalisch manifestieren können, daß sie
sich selbst alle möglichen Namen beilegen, daß
aber jeder zwingende Beweis fehlt, der sie als
überlebende geistige Individualitäten «gestorbe‐
ner» Erdenmenschen dartun würde. ‒ Es ist und
bleibt reine Glaubenssache, ob man sie als solche
ansehen mag oder nicht. ‒ ‒
daß man es, ihren eigenen Angaben nach, hier
mit «Geistern Verstorbener» zu tun habe, einmal
gänzlich fallen lassen wollte, besonders, da die post‐
humen Äußerungen dieser vermeintlichen Gei‐
ster doch in den weitaus meisten Fällen sehr
merkwürdige Kontraste mit ihrer Geistigkeit bil‐
den, die sie im Körper der Erde dokumentierten
und die nur durch einen schreckenerregenden
Rückschritt zu erklären wären? ‒ (Selbst «Gott‐
Vater» und der «Erzengel Gabriel» bringen es
über triviale Salbadereien nicht hinaus!)
.Wie wäre es, wenn wir es hier mit einer Wesens‐
reihe zu tun hätten, die zwar unseren Sinnen
nicht faßbar ist, aber dennoch einen Bestandteil
dieser physischen Welt bildet? ‒ Haben wir wirklich
schon alles entdeckt, was auf dieser Erde an Irdi‐
schem und dennoch Unsichtbarem zu entdecken
ist? ‒ Ich spreche diese Frage gewiß nicht leicht‐
fertig aus und glaube meine Gründe zu haben, sie
aufzuwerfen.
.Die Frage, ob es überhaupt absolut einwandfreie
Manifestationen «spiritistischer» Art gibt, bejahe
ich auf Grund unanfechtbarer eigener Erfahrung
durchaus, und diese Frage kann auch heute nur
noch von Menschen gestellt werden, denen ent‐
weder das ganze in Rede stehende Gebiet durch‐
aus fremd ist, oder von solchen, die niemals Gele‐
genheit fanden, jeder nur möglichen Kontrolle
zugängliche, keinerlei Täuschungsmöglichkeit
mehr unterworfene Manifestationen aus unsicht‐
ster doch in den weitaus meisten Fällen sehr
merkwürdige Kontraste mit ihrer Geistigkeit bil‐
den, die sie im Körper der Erde dokumentierten
und die nur durch einen schreckenerregenden
Rückschritt zu erklären wären? ‒ (Selbst «Gott‐
Vater» und der «Erzengel Gabriel» bringen es
über triviale Salbadereien nicht hinaus!)
reihe zu tun hätten, die zwar unseren Sinnen
nicht faßbar ist, aber dennoch einen Bestandteil
dieser physischen Welt bildet? ‒ Haben wir wirklich
schon alles entdeckt, was auf dieser Erde an Irdi‐
schem und dennoch Unsichtbarem zu entdecken
ist? ‒ Ich spreche diese Frage gewiß nicht leicht‐
fertig aus und glaube meine Gründe zu haben, sie
aufzuwerfen.
Manifestationen «spiritistischer» Art gibt, bejahe
ich auf Grund unanfechtbarer eigener Erfahrung
durchaus, und diese Frage kann auch heute nur
noch von Menschen gestellt werden, denen ent‐
weder das ganze in Rede stehende Gebiet durch‐
aus fremd ist, oder von solchen, die niemals Gele‐
genheit fanden, jeder nur möglichen Kontrolle
zugängliche, keinerlei Täuschungsmöglichkeit
mehr unterworfene Manifestationen aus unsicht‐
barer Quelle zu erleben. Auch denen könnten die
Erfahrungen von Männern wie Crookes, Lombroso,
Schiaparelli, Zöllner, Richet, Rochas, Baraduc und
von vielen anderen doch zu denken geben... Mit
Schopenhauer möchte ich sagen: «Wer diese Tatsa‐
che leugnet, ist nicht ungläubig, sondern unwissend
zu nennen.» ‒
.Ich will auch durchaus nicht in Abrede stellen,
daß diese Manifestationen sehr oft den Glauben
nahelegen können, man habe es mit Äußerungen
Abgeschiedener zu tun, ja daß es selbst möglich
sein könne, daß gelegentlich eine menschliche En‐
telechie, sei sie nun noch an irdische Körperlich‐
keit gebunden oder nicht, als «spiritus rector» sich
solcher Manifestationen bediene. Trotz alledem
aber glaube ich allen Grund zu haben, die eigent‐
lichen Urheber aller spiritistischen Manifestationen,
also aller Vorkommnisse, zu deren Erklärung die
animistische Erklärungsweise nicht ausreicht (die
also nicht durch eigene Seelenkräfte erklärbar
sind), als Wesen einer uns unbekannten, in der
physischen Welt lebenden, unsichtbaren Wesensreihe
ansprechen zu dürfen, und meine, allerdings aus
gewissen Gründen nur mir persönlich zugängli‐
chen Beweise würden auch selbst durch die stau‐
nenerregendsten Erfolge des Edisonschen Appa‐
rates nicht im mindesten zu erschüttern sein.
Erfahrungen von Männern wie Crookes, Lombroso,
Schiaparelli, Zöllner, Richet, Rochas, Baraduc und
von vielen anderen doch zu denken geben... Mit
Schopenhauer möchte ich sagen: «Wer diese Tatsa‐
che leugnet, ist nicht ungläubig, sondern unwissend
zu nennen.» ‒
daß diese Manifestationen sehr oft den Glauben
nahelegen können, man habe es mit Äußerungen
Abgeschiedener zu tun, ja daß es selbst möglich
sein könne, daß gelegentlich eine menschliche En‐
telechie, sei sie nun noch an irdische Körperlich‐
keit gebunden oder nicht, als «spiritus rector» sich
solcher Manifestationen bediene. Trotz alledem
aber glaube ich allen Grund zu haben, die eigent‐
lichen Urheber aller spiritistischen Manifestationen,
also aller Vorkommnisse, zu deren Erklärung die
animistische Erklärungsweise nicht ausreicht (die
also nicht durch eigene Seelenkräfte erklärbar
sind), als Wesen einer uns unbekannten, in der
physischen Welt lebenden, unsichtbaren Wesensreihe
ansprechen zu dürfen, und meine, allerdings aus
gewissen Gründen nur mir persönlich zugängli‐
chen Beweise würden auch selbst durch die stau‐
nenerregendsten Erfolge des Edisonschen Appa‐
rates nicht im mindesten zu erschüttern sein.
.Der Beweis vom Fortleben des Menschengeistes
nach dem Tode ist hier nie und nimmer zu finden
trotz der enormen Ausbreitung der spiritistischen
Glaubenssätze, trotz der über 30000 Bände um‐
fassenden spiritistischen Literatur. Wer diesen Be‐
weis nicht in einer für ihn selbst zwingenden Art in
sich selbst zu finden vermag, der wird ihn in der Welt
der äußeren Sinne vergeblich suchen und im be‐
sten Falle nur der Täuschungslust tief unter ihm
stehender Wesen erliegen, die ihn nur gläubig
finden, weil er nicht imstande ist, sie zu sehen. ‒
Was er gelegentlich, bei den doch immerhin rela‐
tiv seltenen echten «Materialisationen» angeblich
Gestorbener zu sehen bekommt, sind, trotz aller
Ähnlichkeit niemals jene Gestorbenen, sondern
gleichsam galvanisierte astrale Larven, wie sie
jede irdische Erscheinung in der Aura dieses
Weltkörpers zurückläßt, erborgte Masken, deren
sich jene, mir mehr als wünschenswert bekannten
unsichtbaren Wesen bedienen, um ihre Rufer er‐
folgreich zu äffen. ‒ («Materialisationsphäno‐
mene», wie sie Schrenk-Notzing zu untersuchen
Gelegenheit fand, tragen ihren Namen zu Un‐
recht und sind durchaus auf animistischer Basis, als
abnorme psycho-physische Erscheinungen, aber
niemals als echte Materialisationen, wie sie z.B.
Crookes erlebte, anzusprechen.) Es wäre sehr zu
bedauern, wenn etwa durch Edisons Erfindung
nach dem Tode ist hier nie und nimmer zu finden
trotz der enormen Ausbreitung der spiritistischen
Glaubenssätze, trotz der über 30000 Bände um‐
fassenden spiritistischen Literatur. Wer diesen Be‐
weis nicht in einer für ihn selbst zwingenden Art in
sich selbst zu finden vermag, der wird ihn in der Welt
der äußeren Sinne vergeblich suchen und im be‐
sten Falle nur der Täuschungslust tief unter ihm
stehender Wesen erliegen, die ihn nur gläubig
finden, weil er nicht imstande ist, sie zu sehen. ‒
Was er gelegentlich, bei den doch immerhin rela‐
tiv seltenen echten «Materialisationen» angeblich
Gestorbener zu sehen bekommt, sind, trotz aller
Ähnlichkeit niemals jene Gestorbenen, sondern
gleichsam galvanisierte astrale Larven, wie sie
jede irdische Erscheinung in der Aura dieses
Weltkörpers zurückläßt, erborgte Masken, deren
sich jene, mir mehr als wünschenswert bekannten
unsichtbaren Wesen bedienen, um ihre Rufer er‐
folgreich zu äffen. ‒ («Materialisationsphäno‐
mene», wie sie Schrenk-Notzing zu untersuchen
Gelegenheit fand, tragen ihren Namen zu Un‐
recht und sind durchaus auf animistischer Basis, als
abnorme psycho-physische Erscheinungen, aber
niemals als echte Materialisationen, wie sie z.B.
Crookes erlebte, anzusprechen.) Es wäre sehr zu
bedauern, wenn etwa durch Edisons Erfindung
eine neue Verwirrung der Geister ‒ aber der in
Gehirnen tätigen ‒ Platz greifen würde; denn die
Enttäuschung wäre zum Schlusse unvermeidbar,
und für viele würde sie nur ein Zurücksinken in
flachste materialistische Denkungsart, ein Verfal‐
len in trostlosen Zynismus bedeuten. Wen Natur
nicht selbst dazu befähigt hat, dem sinnlich Uner‐
forschlichen auf übersinnliche Art zu nahen, der
bleibe ferne einer Region, die zu seinem eigenen
Besten vor seinen Augen verborgen bleibt, und er
«begehre nimmer zu schauen», was die Götter
«gnädig verhüllten mit Nacht und Grauen!» ‒ ‒
Gehirnen tätigen ‒ Platz greifen würde; denn die
Enttäuschung wäre zum Schlusse unvermeidbar,
und für viele würde sie nur ein Zurücksinken in
flachste materialistische Denkungsart, ein Verfal‐
len in trostlosen Zynismus bedeuten. Wen Natur
nicht selbst dazu befähigt hat, dem sinnlich Uner‐
forschlichen auf übersinnliche Art zu nahen, der
bleibe ferne einer Region, die zu seinem eigenen
Besten vor seinen Augen verborgen bleibt, und er
«begehre nimmer zu schauen», was die Götter
«gnädig verhüllten mit Nacht und Grauen!» ‒ ‒
FRAU Helena Petrowna Blavatski gründete im
Jahre 1875 zu New York die «Theosophical
Society». Die Beziehung auf das Wort «Theoso‐
phie» erschien in diesem Titel, nachdem eine vor‐
angegangene Gründung, der «Miracle Club»,
nicht den erhofften Anklang gefunden hatte, und
stammt von dem, später durch seinen «buddhisti‐
schen Katechismus» bekannt gewordenen Ameri‐
kaner Olcott, der auch der erste Präsident der Ge‐
sellschaft wurde.
.Seit ihrem zwölften Jahre hatte sich Frau Bla‐
vatski, geb. von Hahn-Hahn, als spiritistisches Me‐
dium betätigt. Im Jahre 1871 noch gründete sie in
Kairo die «Société spirite», und noch kurz vor der
Umwandlung des «Miracle Club» in eine «Theoso‐
phische» Gesellschaft, wußte sie durchaus nichts
von indischen oder tibetanischen «Mahâtmas»,
sondern kannte nur ihren «Kontrollgeist» John
King. ‒
.Eine Änderung trat erst ein, als sie mit einem
Privatgelehrten Felt in Verbindung kam, der auf
Jahre 1875 zu New York die «Theosophical
Society». Die Beziehung auf das Wort «Theoso‐
phie» erschien in diesem Titel, nachdem eine vor‐
angegangene Gründung, der «Miracle Club»,
nicht den erhofften Anklang gefunden hatte, und
stammt von dem, später durch seinen «buddhisti‐
schen Katechismus» bekannt gewordenen Ameri‐
kaner Olcott, der auch der erste Präsident der Ge‐
sellschaft wurde.
vatski, geb. von Hahn-Hahn, als spiritistisches Me‐
dium betätigt. Im Jahre 1871 noch gründete sie in
Kairo die «Société spirite», und noch kurz vor der
Umwandlung des «Miracle Club» in eine «Theoso‐
phische» Gesellschaft, wußte sie durchaus nichts
von indischen oder tibetanischen «Mahâtmas»,
sondern kannte nur ihren «Kontrollgeist» John
King. ‒
Privatgelehrten Felt in Verbindung kam, der auf
seine Weise das Studium antiker Kulte betrieb
und eine reichhaltige Bibliothek seltener okkulti‐
stischer Werke besaß.
.Hier lernte Frau Blavatski plötzlich so manches
kennen, das bis dahin nicht in ihren Gesichtskreis
getreten war, und ihr Ehrgeiz, ihre ausgeprägte
Eitelkeit, fanden sich sehr wenig schmeichelhaft
berührt durch die Auffassung Felts in bezug auf
den Spiritismus.
.Die Folge davon war, daß durch eine energisch
erzwungene Transfiguration aus ihrem «Kon‐
trollgeist» John King ein «Mahâtma», ein im fer‐
nen Tibet verborgen lebender «Wissender» und
Beherrscher der okkulten Kräfte der Natur, ‒ ihr
erster «Meister der Weisheit» wurde. ‒ ‒
.Alle okkulten, spiritistischen Phänomene, die
sie seit früher Jugend begleitet hatten, wurden
von ihr nun diesem «Meister» zugeschrieben.
.Aus den Aufschlüssen, die ihr bei Felt und in
dessen Bibliothek seltener okkultistischer und
mystischer Schriften geworden waren, hatte sie
bereits die Überzeugung geschöpft, daß es ir‐
gendwie und irgendwo auf der Welt eine verbor‐
gene, keinem, außer ihren Angehörigen und de‐
ren erwählten Nachfolgern, zugängliche geistige
Gemeinschaft geben müsse, und selbstverständ‐
und eine reichhaltige Bibliothek seltener okkulti‐
stischer Werke besaß.
kennen, das bis dahin nicht in ihren Gesichtskreis
getreten war, und ihr Ehrgeiz, ihre ausgeprägte
Eitelkeit, fanden sich sehr wenig schmeichelhaft
berührt durch die Auffassung Felts in bezug auf
den Spiritismus.
erzwungene Transfiguration aus ihrem «Kon‐
trollgeist» John King ein «Mahâtma», ein im fer‐
nen Tibet verborgen lebender «Wissender» und
Beherrscher der okkulten Kräfte der Natur, ‒ ihr
erster «Meister der Weisheit» wurde. ‒ ‒
sie seit früher Jugend begleitet hatten, wurden
von ihr nun diesem «Meister» zugeschrieben.
dessen Bibliothek seltener okkultistischer und
mystischer Schriften geworden waren, hatte sie
bereits die Überzeugung geschöpft, daß es ir‐
gendwie und irgendwo auf der Welt eine verbor‐
gene, keinem, außer ihren Angehörigen und de‐
ren erwählten Nachfolgern, zugängliche geistige
Gemeinschaft geben müsse, und selbstverständ‐
lich war nun ihr «Meister», alias John King, ein
Zugehöriger dieser geistigen Gemeinschaft. ‒
.Einmal nach dieser Richtung hin auf der Suche,
gelang es ihr auch, auf Grund ihrer abnorm star‐
ken medialen Veranlagung, sowie im somnam‐
bulen Zustand, zwingende Beweise von dem Da‐
sein einer solchen geistigen Gemeinschaft zu er‐
halten, manches sorglichst Geheimgehaltene, das
von dieser Gemeinschaft ausging, gleichsam mit‐
anzuhören, wie etwa ein unberufener Dritter das
Gespräch zweier Telephonteilnehmer «abhören»
kann. ‒
.Nun kam die Zeit, in der sie jedem mehr oder
weniger bedenklichen Einfluß okkulter Art hem‐
mungslos unterlag, wie ich das an anderer Stelle
bereits beschrieben habe.
.Jeder solcher Einfluß wurde von ihr einem An‐
gehörigen jener geistigen Gemeinschaft zuge‐
schrieben, die sie in ihrer Wundersucht so völlig
verkannte und zu der sie niemals in Beziehung tre‐
ten konnte, da ihr dazu alle Vorbedingungen völ‐
lig fehlten. ‒ Es entstand bald der zweite «Mei‐
ster», dann wurden ihrer noch mehrere aktiv,
und hiermit war die «Weiße Loge» ‒ ein Wort aus
dem Sprachschatz Felts ‒ nach Frau Blavatskis Mei‐
nung, hinter der ihre glühendsten Wünsche stan‐
Zugehöriger dieser geistigen Gemeinschaft. ‒
gelang es ihr auch, auf Grund ihrer abnorm star‐
ken medialen Veranlagung, sowie im somnam‐
bulen Zustand, zwingende Beweise von dem Da‐
sein einer solchen geistigen Gemeinschaft zu er‐
halten, manches sorglichst Geheimgehaltene, das
von dieser Gemeinschaft ausging, gleichsam mit‐
anzuhören, wie etwa ein unberufener Dritter das
Gespräch zweier Telephonteilnehmer «abhören»
kann. ‒
weniger bedenklichen Einfluß okkulter Art hem‐
mungslos unterlag, wie ich das an anderer Stelle
bereits beschrieben habe.
gehörigen jener geistigen Gemeinschaft zuge‐
schrieben, die sie in ihrer Wundersucht so völlig
verkannte und zu der sie niemals in Beziehung tre‐
ten konnte, da ihr dazu alle Vorbedingungen völ‐
lig fehlten. ‒ Es entstand bald der zweite «Mei‐
ster», dann wurden ihrer noch mehrere aktiv,
und hiermit war die «Weiße Loge» ‒ ein Wort aus
dem Sprachschatz Felts ‒ nach Frau Blavatskis Mei‐
nung, hinter der ihre glühendsten Wünsche stan‐
den, zu ihr in handgreifliche Beziehung getreten.
‒ Sie wurde die «Dienerin der Meister» ‒ und
ahnte wohl bis zu ihrem Tode nicht, daß ihre un‐
gestümen Wünsche sie erst zum Selbstbetrug ver‐
leitet hatten, um sie dann zu einer willigen Sklavin
bedenklicher okkultischer Praktiker zu machen. ‒
.Sie ahnte wohl nicht, daß sie auch in den relativ
harmlosesten Fällen nur das Opfer mystisch gerich‐
teter Schwärmer war. ‒ ‒
.Bis zu ihrem Tode spiritistisches Medium, von
seltenen und abnorm starken Phänomenen be‐
gleitet, glaubte sie sich hoch erhaben über jeden
Zusammenhang mit spiritistischen Manifestatio‐
nen und sprach sich späterhin stets in der abfällig‐
sten Weise über den «Spiritismus» aus, immer in
der nach und nach bei ihr stets fester wurzelnden
Meinung, ihr «Kontrollgeist» John King sei von
ihr nur früher verkannt worden, und sie stehe
also schon von Kindheit an unter der Leitung der
«Meister». ‒
.Diese außerordentlich merkwürdige und hoch‐
begabte Frau diente aber dennoch indirekt der Ge‐
meinschaft des Geistes, mit der sie sich seit dem
Jahre 1875 in Verbindung glaubte...
.Durch ihr eigenes impulsives Werben, und
durch das Tam-Tam ihrer Anhänger wurde die
‒ Sie wurde die «Dienerin der Meister» ‒ und
ahnte wohl bis zu ihrem Tode nicht, daß ihre un‐
gestümen Wünsche sie erst zum Selbstbetrug ver‐
leitet hatten, um sie dann zu einer willigen Sklavin
bedenklicher okkultischer Praktiker zu machen. ‒
harmlosesten Fällen nur das Opfer mystisch gerich‐
teter Schwärmer war. ‒ ‒
seltenen und abnorm starken Phänomenen be‐
gleitet, glaubte sie sich hoch erhaben über jeden
Zusammenhang mit spiritistischen Manifestatio‐
nen und sprach sich späterhin stets in der abfällig‐
sten Weise über den «Spiritismus» aus, immer in
der nach und nach bei ihr stets fester wurzelnden
Meinung, ihr «Kontrollgeist» John King sei von
ihr nur früher verkannt worden, und sie stehe
also schon von Kindheit an unter der Leitung der
«Meister». ‒
begabte Frau diente aber dennoch indirekt der Ge‐
meinschaft des Geistes, mit der sie sich seit dem
Jahre 1875 in Verbindung glaubte...
durch das Tam-Tam ihrer Anhänger wurde die
Aufmerksamkeit weiter Kreise erregt, und eine
dunkle Kunde aus ferner Vorzeit, nur da und
dort in orakelhaften Andeutungen noch erhalten,
erhielt wieder Sinn und Leben.
.Man erwog zum wenigsten wieder die Möglich‐
keit, daß eine verborgene geistige Gemeinschaft
auf dieser Erde bestehen könne, wenn auch kritik‐
fähigeren Köpfen jene spiritistischen Phäno‐
mene, durch die das Dasein einer solchen Ge‐
meinschaft «bewiesen» werden sollte, jene allzu
albernen okkulten Kunststücke: ‒ herbeigezau‐
berte Tassen und Broschen, Briefe, die in ver‐
nähte Kissen hineineskamotiert wurden, verzau‐
berte und an anderen Stellen wieder zum Vor‐
schein gebrachte Zigaretten, auf mysteriöse Weise
erhaltene Antworten auf Briefe an die «Mahât‐
mas», bei denen die Antwort im uneröffneten Ku‐
vert des Briefes zu finden war, und ähnliches
mehr ‒ ‒ recht wenig mit der doch immerhin anzu‐
nehmenden Selbstachtung einer solchen hohen
geistigen Gemeinschaft in Einklang zu stehen
schienen. ‒ ‒
.In den mächtigen Folianten, die von Frau Bla‐
vatski medianim niedergeschrieben wurden, fand
sich, neben einem Wust absurder Annahmen,
doch auch manches, das sich mehr oder weniger
unter oder auch über der «Schwelle ihres Bewußt‐
dunkle Kunde aus ferner Vorzeit, nur da und
dort in orakelhaften Andeutungen noch erhalten,
erhielt wieder Sinn und Leben.
keit, daß eine verborgene geistige Gemeinschaft
auf dieser Erde bestehen könne, wenn auch kritik‐
fähigeren Köpfen jene spiritistischen Phäno‐
mene, durch die das Dasein einer solchen Ge‐
meinschaft «bewiesen» werden sollte, jene allzu
albernen okkulten Kunststücke: ‒ herbeigezau‐
berte Tassen und Broschen, Briefe, die in ver‐
nähte Kissen hineineskamotiert wurden, verzau‐
berte und an anderen Stellen wieder zum Vor‐
schein gebrachte Zigaretten, auf mysteriöse Weise
erhaltene Antworten auf Briefe an die «Mahât‐
mas», bei denen die Antwort im uneröffneten Ku‐
vert des Briefes zu finden war, und ähnliches
mehr ‒ ‒ recht wenig mit der doch immerhin anzu‐
nehmenden Selbstachtung einer solchen hohen
geistigen Gemeinschaft in Einklang zu stehen
schienen. ‒ ‒
vatski medianim niedergeschrieben wurden, fand
sich, neben einem Wust absurder Annahmen,
doch auch manches, das sich mehr oder weniger
unter oder auch über der «Schwelle ihres Bewußt‐
seins», aus der Feltschen Bibliothek hierher geret‐
tet hatte und immerhin zu denken gab.
.Eine gigantische, aber mehr noch gigantisch‐
phantastische Kosmogonie bewirkte, neben der
Verwirrung, die sie in glaubensfreudigen Gehir‐
nen anrichtete, immerhin eine ins kosmische ver‐
breiterte Ausdehnung des Gesichtskreises bei gar
vielen, die vorher nicht die Anregung gefunden
hatten, über einen allzuengen dogmenumhegten
Umkreis hinauszublicken.
.Gewisse alte Weisheitslehren standen wieder
auf, allerdings umgeben von Gespenstern aus den
Gräbern modernden Aberglaubens aller Art, und
behängt mit den seltsamsten Draperien aus zu‐
sammengeflickten Fetzen der ausgetragenen
Priestergewänder aller Zeiten und Völker.
.Trotz allem Tiefbeklagenswerten, das aus dem
ungestümen Wirken dieser rastlos tätigen Frau
resultierte, entstand auf solche Weise doch auch
ein erneutes Interesse in einer nahezu den Denk‐
schablonen des Materialismus verfallenen Welt,
das die Geister wieder dazu bewog, sich auf ihren
Ursprung zu besinnen.
.Es wurden Vorbedingungen geschaffen, die zu
einem Verstehen der übersinnlichen Dinge hinlei‐
ten können, auch wenn das, was gegeben ward, so
tet hatte und immerhin zu denken gab.
phantastische Kosmogonie bewirkte, neben der
Verwirrung, die sie in glaubensfreudigen Gehir‐
nen anrichtete, immerhin eine ins kosmische ver‐
breiterte Ausdehnung des Gesichtskreises bei gar
vielen, die vorher nicht die Anregung gefunden
hatten, über einen allzuengen dogmenumhegten
Umkreis hinauszublicken.
auf, allerdings umgeben von Gespenstern aus den
Gräbern modernden Aberglaubens aller Art, und
behängt mit den seltsamsten Draperien aus zu‐
sammengeflickten Fetzen der ausgetragenen
Priestergewänder aller Zeiten und Völker.
ungestümen Wirken dieser rastlos tätigen Frau
resultierte, entstand auf solche Weise doch auch
ein erneutes Interesse in einer nahezu den Denk‐
schablonen des Materialismus verfallenen Welt,
das die Geister wieder dazu bewog, sich auf ihren
Ursprung zu besinnen.
einem Verstehen der übersinnlichen Dinge hinlei‐
ten können, auch wenn das, was gegeben ward, so
wie es vorliegt, eher geeignet erscheint, von ihnen
abzuleiten. ‒
.So mannigfach auch die Irrtümer sein mögen,
die gutgläubig, auf die mysteriöse Autorität der
Frau Blavatski hin, in der Welt verbreitet wurden,
so übergab sie doch auch der heutigen Zeit eine
Fülle okkulter Begriffe, die schwerlich ohne das
Wirken dieser Frau gangbare Münze geworden
wären.
.Ich neige auch sehr zu der Ansicht, daß ein
Mensch, der bereits geschult wurde durch die
Lehren, denen er in der «Theosophischen Gesell‐
schaft» wie überhaupt im Bannkreis der «theoso‐
phischen» Geistesrichtung begegnen kann, ‒ vor‐
ausgesetzt, daß er sein gesundes Urteil nicht
durch den massenweise mit unterlaufenden
Aberglauben umnebeln ließ ‒ ‒ gar manches vor‐
aus hat, wenn er den Weg zum Geiste beschreiten
will, ‒ gegenüber jenen, die niemals von über‐
sinnlichen Dingen hörten, und denen alle Be‐
griffe fehlen, um sich Übersinnliches auch nur
verstandesmäßig faßbar zu machen.
.Wenn die von Frau Blavatski ins Leben gerufene
Gesellschaft wirklich «Theosophia», Gottesweisheit,
vermitteln will, wenn sie mehr als bisher zu einem
segenbringenden Faktor innerhalb der menschli‐
abzuleiten. ‒
die gutgläubig, auf die mysteriöse Autorität der
Frau Blavatski hin, in der Welt verbreitet wurden,
so übergab sie doch auch der heutigen Zeit eine
Fülle okkulter Begriffe, die schwerlich ohne das
Wirken dieser Frau gangbare Münze geworden
wären.
Mensch, der bereits geschult wurde durch die
Lehren, denen er in der «Theosophischen Gesell‐
schaft» wie überhaupt im Bannkreis der «theoso‐
phischen» Geistesrichtung begegnen kann, ‒ vor‐
ausgesetzt, daß er sein gesundes Urteil nicht
durch den massenweise mit unterlaufenden
Aberglauben umnebeln ließ ‒ ‒ gar manches vor‐
aus hat, wenn er den Weg zum Geiste beschreiten
will, ‒ gegenüber jenen, die niemals von über‐
sinnlichen Dingen hörten, und denen alle Be‐
griffe fehlen, um sich Übersinnliches auch nur
verstandesmäßig faßbar zu machen.
Gesellschaft wirklich «Theosophia», Gottesweisheit,
vermitteln will, wenn sie mehr als bisher zu einem
segenbringenden Faktor innerhalb der menschli‐
chen Geistesentfaltung werden soll, dann dürften
ihre Führer gut daran tun, völlig von der Entste‐
hungsgeschichte der Gesellschaft abzusehen, ‒ die
monströsen Folianten der Frau Blavatski als «Ku‐
riosa» zu betrachten und nicht mehr als die «Bi‐
bel» der alleinseligmachenden Theosophie, ‒ alle
allzu phantastischen Auswüchse der Glaubens‐
meinungen ihrer Mitglieder zu beschneiden, ‒
und, als reinlich denkende Lichtsucher, einem
Ziele erst vorurteilsfrei zuzustreben, das die impul‐
sive Gründerin der «Theosophischen Gesell‐
schaft» bereits erreicht glaubte. ‒ ‒ Noch ist es dazu
nicht zu spät.
.Es würde aber eines Tages, und zwar in recht
wohl absehbarer Zeit, «zu spät» sein, trotz der
hochtrabenden Redensarten nicht allzuseltener
Skribenten aus den Reihen der Gesellschaft, und
das voraussehbare Ende würde bedauerlich ge‐
nug sein für alle ernsthaft und ehrlich Suchen‐
den, die innerhalb der theosophischen Geistes‐
richtung die letzten Antworten auf die Fragen ih‐
rer Seele zu finden hofften. ‒
.Bramarbasierende, hochtönende Redensarten
täuschen nur über die Gefahr hinweg. ‒ ‒
.Ebensowenig hilft das Allheilmittel eines kritik‐
losen Eklektizismus, eine geisteslahme «Tole‐
ihre Führer gut daran tun, völlig von der Entste‐
hungsgeschichte der Gesellschaft abzusehen, ‒ die
monströsen Folianten der Frau Blavatski als «Ku‐
riosa» zu betrachten und nicht mehr als die «Bi‐
bel» der alleinseligmachenden Theosophie, ‒ alle
allzu phantastischen Auswüchse der Glaubens‐
meinungen ihrer Mitglieder zu beschneiden, ‒
und, als reinlich denkende Lichtsucher, einem
Ziele erst vorurteilsfrei zuzustreben, das die impul‐
sive Gründerin der «Theosophischen Gesell‐
schaft» bereits erreicht glaubte. ‒ ‒ Noch ist es dazu
nicht zu spät.
wohl absehbarer Zeit, «zu spät» sein, trotz der
hochtrabenden Redensarten nicht allzuseltener
Skribenten aus den Reihen der Gesellschaft, und
das voraussehbare Ende würde bedauerlich ge‐
nug sein für alle ernsthaft und ehrlich Suchen‐
den, die innerhalb der theosophischen Geistes‐
richtung die letzten Antworten auf die Fragen ih‐
rer Seele zu finden hofften. ‒
täuschen nur über die Gefahr hinweg. ‒ ‒
losen Eklektizismus, eine geisteslahme «Tole‐
ranz», die jede leidlich erträgliche, aber auch jede
noch so absurde Eigenbrötelei sonderbarer Heili‐
ger nicht nur gelten läßt, sondern in ihrer inne‐
ren, schlecht verhüllten Unsicherheit, um keinen
Preis zu kritisieren wagt, weil die Furcht im Hin‐
tergrunde steht, just dort, wo es am tollsten ge‐
trieben wird, oder wo gar irgend ein Orientale in
das Getriebe eingreift, müsse wohl doch «etwas
Wahres» zu finden sein, und man könne sich
durch Kritik eine Blöße geben. ‒
.Das alles muß nicht notwendigerweise so blei‐
ben.
.Vor allem aber ist eine rigoros-peinliche Sonde‐
rung des Weizens vom Unkraut vonnöten, hin‐
sichtlich der landläufigen Lehrmeinungen inner‐
halb der «Theosophischen Gesellschaft» und ihrer
Tochtergesellschaften.
Es ist nicht nötig, daß uralte, tiefe Weisheit, daß
ewig gültige kosmische Wahrheiten in «theoso‐
phischer» Darbietung als verzerrte, ‒ oft bis zur
Karikatur verzerrte ‒ Bilder erscheinen! ‒ ‒
.Eine «Textkritik» theosophischer Lehren, aus‐
geübt von Berufenen, ebenso ferne von verant‐
wortungsloser Zerstörungssucht, wie von ängst‐
licher Furcht, durch Streichung liebgewordener,
alter Meinungen Mitglieder zu verlieren, würde
noch so absurde Eigenbrötelei sonderbarer Heili‐
ger nicht nur gelten läßt, sondern in ihrer inne‐
ren, schlecht verhüllten Unsicherheit, um keinen
Preis zu kritisieren wagt, weil die Furcht im Hin‐
tergrunde steht, just dort, wo es am tollsten ge‐
trieben wird, oder wo gar irgend ein Orientale in
das Getriebe eingreift, müsse wohl doch «etwas
Wahres» zu finden sein, und man könne sich
durch Kritik eine Blöße geben. ‒
ben.
rung des Weizens vom Unkraut vonnöten, hin‐
sichtlich der landläufigen Lehrmeinungen inner‐
halb der «Theosophischen Gesellschaft» und ihrer
Tochtergesellschaften.
ewig gültige kosmische Wahrheiten in «theoso‐
phischer» Darbietung als verzerrte, ‒ oft bis zur
Karikatur verzerrte ‒ Bilder erscheinen! ‒ ‒
geübt von Berufenen, ebenso ferne von verant‐
wortungsloser Zerstörungssucht, wie von ängst‐
licher Furcht, durch Streichung liebgewordener,
alter Meinungen Mitglieder zu verlieren, würde
gar bald das wahrhaft Echte finden, und es aus
dem Wust des Unechten, des Abstrusen, und der
mancherlei sonstigen Anhängsel zu retten wis‐
sen. ‒
.Es ist mir nicht unbekannt, daß man schon des
öfteren innerhalb der «Theosophischen Gesell‐
schaft» Stimmen vernehmen konnte, die eine völ‐
lige Preisgabe der Lehre von den «Meistern», den
«älteren Brüdern der Menschheit», forderten.
.Sofern man damit die angeblichen «Meister»:
Koot Hoomi, Morya und andere, kurzum, die
«Meister», die «Mahâtmas» der Frau Blavatski
meint, die Personen, deren rationalistisch dürren
und großsprecherischen Briefe u.a. in A.P. Sin‐
netts «Okkulter Welt» zu finden sind, ‒ dann hat
man wahrlich allen Grund, sich endlich loszu‐
sagen. ‒ ‒
.Man würde aber einen sehr verhängnisvollen
Fehlschritt tun, wollte man zu gleicher Zeit das
wenige in Bausch und Bogen mit verloren geben,
was man immerhin durch Frau Blavatski, wenn
auch also aus einer arg getrübten Quelle, über das
Bestehen einer rein geistlichen Gemeinschaft in‐
nerhalb des Menschentums auf dieser Erde erfah‐
ren hat...
dem Wust des Unechten, des Abstrusen, und der
mancherlei sonstigen Anhängsel zu retten wis‐
sen. ‒
öfteren innerhalb der «Theosophischen Gesell‐
schaft» Stimmen vernehmen konnte, die eine völ‐
lige Preisgabe der Lehre von den «Meistern», den
«älteren Brüdern der Menschheit», forderten.
Koot Hoomi, Morya und andere, kurzum, die
«Meister», die «Mahâtmas» der Frau Blavatski
meint, die Personen, deren rationalistisch dürren
und großsprecherischen Briefe u.a. in A.P. Sin‐
netts «Okkulter Welt» zu finden sind, ‒ dann hat
man wahrlich allen Grund, sich endlich loszu‐
sagen. ‒ ‒
Fehlschritt tun, wollte man zu gleicher Zeit das
wenige in Bausch und Bogen mit verloren geben,
was man immerhin durch Frau Blavatski, wenn
auch also aus einer arg getrübten Quelle, über das
Bestehen einer rein geistlichen Gemeinschaft in‐
nerhalb des Menschentums auf dieser Erde erfah‐
ren hat...
.Zwar steht diese Gemeinschaft des reinen Gei‐
stes auf diesem Planeten nicht am Ausgangspunkt
der «Theosophischen Gesellschaft», aber ‒ sie und
ihre geistige Führung zu erreichen, muß das Ziel ei‐
nes jeden, wahrhaft im Sinne des Wortes «theoso‐
phisch» Strebenden sein, will er wirklich den Weg
zum Geiste, den Weg zum Urlicht finden, den ein‐
zigen Weg, den das geistige Urlicht dem Menschen
dieser Erde selbst bereitet hat. ‒ ‒ ‒
.Jeder Wanderer, der sich etwa berufen glauben
sollte, einen Weg zu finden, der an diesem einzi‐
gen Wege vorbei führt, ihn umgehen will, und den‐
noch das Leben im reinen Geiste, im Urlicht, zu
erreichen hofft, wird ein Opfer seines Wähnens,
gerät unvermeidlich auf Irrwege und wird nie‐
mals wahrhaft in des Geistes lebenspendendes
Licht gelangen. ‒
.Es ist gewiß nicht nötig, von jener geistigen Ge‐
meinschaft zu wissen, die das Urlicht selbst sich auf
Erden zum «Wege» bereitet hat, aber wer einmal
von ihr weiß, oder annimmt, daß sie bestehe, und
dann eine Willensrichtung einschlägt, die ihm die
Hilfe vermeiden läßt, die ihm werden könnte, der
darf sich nicht wundern, wenn er in all seiner trü‐
gerischen Selbstsicherheit niemals finden wird,
was er sucht, mag er auch die scheinbar besten
stes auf diesem Planeten nicht am Ausgangspunkt
der «Theosophischen Gesellschaft», aber ‒ sie und
ihre geistige Führung zu erreichen, muß das Ziel ei‐
nes jeden, wahrhaft im Sinne des Wortes «theoso‐
phisch» Strebenden sein, will er wirklich den Weg
zum Geiste, den Weg zum Urlicht finden, den ein‐
zigen Weg, den das geistige Urlicht dem Menschen
dieser Erde selbst bereitet hat. ‒ ‒ ‒
sollte, einen Weg zu finden, der an diesem einzi‐
gen Wege vorbei führt, ihn umgehen will, und den‐
noch das Leben im reinen Geiste, im Urlicht, zu
erreichen hofft, wird ein Opfer seines Wähnens,
gerät unvermeidlich auf Irrwege und wird nie‐
mals wahrhaft in des Geistes lebenspendendes
Licht gelangen. ‒
meinschaft zu wissen, die das Urlicht selbst sich auf
Erden zum «Wege» bereitet hat, aber wer einmal
von ihr weiß, oder annimmt, daß sie bestehe, und
dann eine Willensrichtung einschlägt, die ihm die
Hilfe vermeiden läßt, die ihm werden könnte, der
darf sich nicht wundern, wenn er in all seiner trü‐
gerischen Selbstsicherheit niemals finden wird,
was er sucht, mag er auch die scheinbar besten
Gründe für sein törichtes Tun in Anschlag brin‐
gen. ‒
.Es wäre gewiß ein seltsamer Glaube, wollte etwa
ein Mensch, der von jener Gemeinschaft des Gei‐
stes hörte, in aller Einfalt annehmen, diese
«Weiße Loge» sei eine Korporation mit menschli‐
cher Satzung, benannt mit irgend einem Namen,
‒ und ihre Glieder führten den Titel «Meister». ‒
.Meister nennt man auf dieser Erde einen jeden,
der in irgend einem Können Vollendung er‐
reichte. Das Wort schließt nach altem Hand‐
werksbrauch in sich, daß der also Bezeichnete die
Prüfung seiner Kräfte bestanden hat, und in sol‐
chem Sinne mag es auch berechtigt erscheinen,
die Glieder jener geistigen Gemeinschaft «Mei‐
ster» zu nennen, obwohl sich keines ihrer Glieder
selbst so nennen wird.
.Aber zu gleicher Zeit drückt das Wort «Meister»
eine Art Anerkennung pesönlicher Verdienste
aus, und von diesem Gesichtspunkt her betrachtet,
ist es geboten, stets dessen eingedenk zu sein, daß
dieses Wort nur als Notbehelf erscheint, denn
jeder, den man so in Kürze als «Meister» be‐
zeichnen mag, ist das, was er ist, ohne eigenes Ver‐
dienst. ‒
gen. ‒
ein Mensch, der von jener Gemeinschaft des Gei‐
stes hörte, in aller Einfalt annehmen, diese
«Weiße Loge» sei eine Korporation mit menschli‐
cher Satzung, benannt mit irgend einem Namen,
‒ und ihre Glieder führten den Titel «Meister». ‒
der in irgend einem Können Vollendung er‐
reichte. Das Wort schließt nach altem Hand‐
werksbrauch in sich, daß der also Bezeichnete die
Prüfung seiner Kräfte bestanden hat, und in sol‐
chem Sinne mag es auch berechtigt erscheinen,
die Glieder jener geistigen Gemeinschaft «Mei‐
ster» zu nennen, obwohl sich keines ihrer Glieder
selbst so nennen wird.
eine Art Anerkennung pesönlicher Verdienste
aus, und von diesem Gesichtspunkt her betrachtet,
ist es geboten, stets dessen eingedenk zu sein, daß
dieses Wort nur als Notbehelf erscheint, denn
jeder, den man so in Kürze als «Meister» be‐
zeichnen mag, ist das, was er ist, ohne eigenes Ver‐
dienst. ‒
.Man kann nicht ein Glied der Gemeinschaft im
Geiste auf dieser Erde werden, indem man gewisse
Stufen ersteigt, um schließlich zur «Meisterschaft»
zu gelangen.
.Der «Meister», sofern mit diesem Worte einer
dieser Gemeinschaft, einer der «Leuchtenden des
Urlichts», bezeichnet werden soll, wird als solcher
geboren, und alle okkulte Schulung, die er unter
der Leitung Vollendeter zu durchleben hat, alle
Prüfung seiner Kräfte, dient lediglich nur dazu,
ihn fähig zu machen, sein eingeborenes Erbe ge‐
brauchen zu lernen. ‒
.Er hat niemals erstrebt, zu werden, was man mit
dem Worte «Meister» bezeichnet, wenn man da‐
mit ein Glied der Gemeinschaft des Geistes be‐
nennen will.
.Als er bewußt zur Fähigkeit gereift war, das, was
der Geist von ihm verlangte, tun zu können, gab es
für ihn keine Wahl. ‒ Er mußte die Bürde überneh‐
men, die ihm zu tragen gegeben war. ‒ ‒ ‒
.Man möge nicht zu sehr an Worten kleben blei‐
ben und nicht willkürlich gewählten Benennun‐
gen einen ungebührlich großen Wert verleihen!
.Es kommt auf eine Erfassung der realen Gegeben‐
heit an und nicht auf die Namen, mit denen die
Geiste auf dieser Erde werden, indem man gewisse
Stufen ersteigt, um schließlich zur «Meisterschaft»
zu gelangen.
dieser Gemeinschaft, einer der «Leuchtenden des
Urlichts», bezeichnet werden soll, wird als solcher
geboren, und alle okkulte Schulung, die er unter
der Leitung Vollendeter zu durchleben hat, alle
Prüfung seiner Kräfte, dient lediglich nur dazu,
ihn fähig zu machen, sein eingeborenes Erbe ge‐
brauchen zu lernen. ‒
dem Worte «Meister» bezeichnet, wenn man da‐
mit ein Glied der Gemeinschaft des Geistes be‐
nennen will.
der Geist von ihm verlangte, tun zu können, gab es
für ihn keine Wahl. ‒ Er mußte die Bürde überneh‐
men, die ihm zu tragen gegeben war. ‒ ‒ ‒
ben und nicht willkürlich gewählten Benennun‐
gen einen ungebührlich großen Wert verleihen!
heit an und nicht auf die Namen, mit denen die
Sprache, mehr oder minder dürftig, das Gege‐
bene benennt. ‒
.Man mag immerhin die eingebürgerten Worte
gebrauchen und von einer «Weißen Loge» und
ihren Meistern reden, wie ich ja auch in meine
Schriften unbedenklich diese Worte übernom‐
men habe, aber man sei dabei stets bewußt, daß es
sich hier nur um frei gewählte Benennungen handelt,
und daß die hohe Gemeinschaft und Alleinheit im
Geiste, die sich hier auf dieser Erde in wenigen
Menschen eines jeden Zeitalters darstellt, keinerlei
Namen und keinerlei Titel gebraucht, um ihrer
Lenkung gemäß die Brücke zu bilden, über die
für den Menschen dieser Erde der Weg zu den
ewigen Hierarchien des Geistes und durch sie
hindurch, zum wesenhaften Urlicht führt. ‒ ‒ ‒
bene benennt. ‒
gebrauchen und von einer «Weißen Loge» und
ihren Meistern reden, wie ich ja auch in meine
Schriften unbedenklich diese Worte übernom‐
men habe, aber man sei dabei stets bewußt, daß es
sich hier nur um frei gewählte Benennungen handelt,
und daß die hohe Gemeinschaft und Alleinheit im
Geiste, die sich hier auf dieser Erde in wenigen
Menschen eines jeden Zeitalters darstellt, keinerlei
Namen und keinerlei Titel gebraucht, um ihrer
Lenkung gemäß die Brücke zu bilden, über die
für den Menschen dieser Erde der Weg zu den
ewigen Hierarchien des Geistes und durch sie
hindurch, zum wesenhaften Urlicht führt. ‒ ‒ ‒
WENN ich hier von neuem wieder zu den Le‐
sern dieser von mir stets hochgeschätzten,
vornehmen theosophischen Zeitschrift spreche,
so geschieht dies auf den Wunsch sehr vieler dieser
Leser hin, den mir der verdienstvolle Heraus‐
geber zu übermitteln die Güte hatte.
.Ich komme heute gerne diesem Wunsche nach,
schon um gewisse Legendenbildungen aus der
Welt zu schaffen, die in mehr oder weniger gehäs‐
siger Weise einen Gegensatz zwischen mir und
dem Herausgeber der «Theosophie» zu konstru‐
ieren unternahmen, besonders da meine letzten
Veröffentlichungen ausschließlich in den «Magi‐
schen Blättern» erschienen.
.Wie falsch diese Annahme einer Gegnerschaft
ist, dürfte schon daraus erhellen, daß das «Theoso‐
phische Verlagshaus»* die alleinige Auslieferungs‐
stelle der «Magischen Blätter» ist, und daß die
Herausgeber beider Zeitschriften, Herr Dr. Hugo
Vollrath und Herr Dr. Richard Hummel, im denkbar
sern dieser von mir stets hochgeschätzten,
vornehmen theosophischen Zeitschrift spreche,
so geschieht dies auf den Wunsch sehr vieler dieser
Leser hin, den mir der verdienstvolle Heraus‐
geber zu übermitteln die Güte hatte.
schon um gewisse Legendenbildungen aus der
Welt zu schaffen, die in mehr oder weniger gehäs‐
siger Weise einen Gegensatz zwischen mir und
dem Herausgeber der «Theosophie» zu konstru‐
ieren unternahmen, besonders da meine letzten
Veröffentlichungen ausschließlich in den «Magi‐
schen Blättern» erschienen.
ist, dürfte schon daraus erhellen, daß das «Theoso‐
phische Verlagshaus»* die alleinige Auslieferungs‐
stelle der «Magischen Blätter» ist, und daß die
Herausgeber beider Zeitschriften, Herr Dr. Hugo
Vollrath und Herr Dr. Richard Hummel, im denkbar
OO
* Anmerkung: dieser Verlag druckte 1916 'WORTE DER MEISTER'- OO
eine Textzusammenstellung von Bô Yin Râ speziell für diesen Leser- OO
kreis (nicht i.d. Nachlese enthalten):->hier
* Anmerkung: dieser Verlag druckte 1916 'WORTE DER MEISTER'- OO
eine Textzusammenstellung von Bô Yin Râ speziell für diesen Leser- OO
kreis (nicht i.d. Nachlese enthalten):->hier
besten, freundlichen Einvernehmen stehen, ein jeder
auf seine Weise durchdrungen von den hohen
geistigen Zielen, denen er in mühevoller Geistes‐
arbeit dient. ‒
.Nach anderer Seite hin glaube ich aber auch jetzt
deutlich genug ausgesprochen zu haben, daß ich
zwar keineswegs von der «Theosophischen Gesell‐
schaft» herkomme, daß ich gegen manche unter ih‐
ren Mitgliedern verbreitete Lehre sehr begrün‐
dete Einwände erheben muß, daß ich aber gewiß
nicht hier als feindlicher Eindringling zu betrach‐
ten bin, sondern warmen Herzens das meinige
dazu beitragen möchte, damit jedes einzelne Mit‐
glied dieser Gesellschaft das hohe Ziel erreiche, das
es letzten Endes doch durch den Anschluß an die
«Theosophische Gesellschaft» zu erreichen hofft.
.So möchte ich denn als freundschaftlicher Be‐
rater vor den Leserkreis dieser weitverbreiteten
Zeitschrift treten, nicht um Meinungsverschie‐
denheiten und Dispute zu veranlassen, sondern
um die großgedachten Einigungsbestrebungen des
Herausgebers auch meinerseits zu stützen, um
aus den Möglichkeiten meiner geistigen Einschau
her, auf jene Dinge hinzuweisen, die mir für ein
gedeihliches und fruchtbringendes Leben der
«Theosophischen Gesellschaft» wichtig erschei‐
nen.
auf seine Weise durchdrungen von den hohen
geistigen Zielen, denen er in mühevoller Geistes‐
arbeit dient. ‒
deutlich genug ausgesprochen zu haben, daß ich
zwar keineswegs von der «Theosophischen Gesell‐
schaft» herkomme, daß ich gegen manche unter ih‐
ren Mitgliedern verbreitete Lehre sehr begrün‐
dete Einwände erheben muß, daß ich aber gewiß
nicht hier als feindlicher Eindringling zu betrach‐
ten bin, sondern warmen Herzens das meinige
dazu beitragen möchte, damit jedes einzelne Mit‐
glied dieser Gesellschaft das hohe Ziel erreiche, das
es letzten Endes doch durch den Anschluß an die
«Theosophische Gesellschaft» zu erreichen hofft.
rater vor den Leserkreis dieser weitverbreiteten
Zeitschrift treten, nicht um Meinungsverschie‐
denheiten und Dispute zu veranlassen, sondern
um die großgedachten Einigungsbestrebungen des
Herausgebers auch meinerseits zu stützen, um
aus den Möglichkeiten meiner geistigen Einschau
her, auf jene Dinge hinzuweisen, die mir für ein
gedeihliches und fruchtbringendes Leben der
«Theosophischen Gesellschaft» wichtig erschei‐
nen.
.Ich habe hier lediglich die «Theosophische Ge‐
sellschaft» im Auge, wie sie heute besteht, als eine
Tempelvereinigung großen Stiles, eine Sammel‐
stätte zum Geiste strebender Menschen unserer
Tage, ganz so, wie sie vom «Theosophischen Haupt‐
quartier» in Leipzig, dem Ausgangspunkt dieser
Zeitschrift, aufgefaßt und vertreten wird.
.Aller Personenkultus scheidet bei den Aufga‐
ben dieser, wie ich annehmen darf in bester Reor‐
ganisation begriffenen Gesellschaft ebenso aus,
wie jede enge Dogmenbindung, und ihr Streben
ist einzig darauf gerichtet, jedem ihrer Mitglieder
alle Wege zu zeigen, die der Seele als Wege zum Gei‐
ste erschienen und noch erscheinen, und wenn ich
die Leitung dieser Zeitschrift richtig verstehe,
dann erwartet sie von ihren Lesern ausreichende
Fähigkeit zu eigener Urteilsbildung und schließt
jede Bevormundung ihrer Leser grundsätzlich
aus.
.Wer wollte bezweifeln, daß auf diese Weise un‐
endlich viel Gutes gewirkt werden kann?!
Nur auf solche Art ist es nach meinem Dafür‐
halten möglich, allmählich die mir innerhalb der
«Theosophischen Gesellschaft» als bedenklich er‐
scheinenden Lehren prüfend in ihrer Unwesen‐
sellschaft» im Auge, wie sie heute besteht, als eine
Tempelvereinigung großen Stiles, eine Sammel‐
stätte zum Geiste strebender Menschen unserer
Tage, ganz so, wie sie vom «Theosophischen Haupt‐
quartier» in Leipzig, dem Ausgangspunkt dieser
Zeitschrift, aufgefaßt und vertreten wird.
ben dieser, wie ich annehmen darf in bester Reor‐
ganisation begriffenen Gesellschaft ebenso aus,
wie jede enge Dogmenbindung, und ihr Streben
ist einzig darauf gerichtet, jedem ihrer Mitglieder
alle Wege zu zeigen, die der Seele als Wege zum Gei‐
ste erschienen und noch erscheinen, und wenn ich
die Leitung dieser Zeitschrift richtig verstehe,
dann erwartet sie von ihren Lesern ausreichende
Fähigkeit zu eigener Urteilsbildung und schließt
jede Bevormundung ihrer Leser grundsätzlich
aus.
endlich viel Gutes gewirkt werden kann?!
halten möglich, allmählich die mir innerhalb der
«Theosophischen Gesellschaft» als bedenklich er‐
scheinenden Lehren prüfend in ihrer Unwesen‐
haftigkeit zu erkennen und ohne Schaden abzu‐
stoßen.
.Nur auf solche Art wird die verjüngte «Theoso‐
phische Gesellschaft» die ewigen Grundlagen einer
wahren Theo-Sophia in ihrem Tempelkreise wie‐
der finden, einer «Theosophie» im tiefsten Sinne des
Wortes, wie sie seit den Tagen des Lao Tse und des
Apostels Paulus bestand, bis hinauf zu Eckehard,
Tauler und Jakob Böhme, wie sie in der alten mysti‐
schen Maurerei gepflegt wurde, und wie sie in In‐
dien zu finden war von Patânjali bis zu Râma‐
krishna. ‒
.Tiefste, wenn auch geheimgehaltene Erkennt‐
nis aller echten «Theosophen» aller Zeiten war stets
vertraut mit diesen Grundlagen, und deren we‐
sentlichste ist das hohe «Wissen» um die einzige Art
und Weise, in der sich die Gottheit den aus ihr ge‐
zeugten Geisteswesenheiten offenbaren kann. ‒ ‒
.Zwecklos würde die Seele suchen, wollte sie je
in unermeßlichen Räumen, wollte sie je in höch‐
sten geistigen Sphären ihrem Gotte begegnen. ‒ ‒
.Sinnlos wären die erhabenen Lehren hoher
Menschheitslehrer, würden die Bilder Gottes, die
sie gestalten, nur einem «Gotte» gelten, der da als
stoßen.
phische Gesellschaft» die ewigen Grundlagen einer
wahren Theo-Sophia in ihrem Tempelkreise wie‐
der finden, einer «Theosophie» im tiefsten Sinne des
Wortes, wie sie seit den Tagen des Lao Tse und des
Apostels Paulus bestand, bis hinauf zu Eckehard,
Tauler und Jakob Böhme, wie sie in der alten mysti‐
schen Maurerei gepflegt wurde, und wie sie in In‐
dien zu finden war von Patânjali bis zu Râma‐
krishna. ‒
nis aller echten «Theosophen» aller Zeiten war stets
vertraut mit diesen Grundlagen, und deren we‐
sentlichste ist das hohe «Wissen» um die einzige Art
und Weise, in der sich die Gottheit den aus ihr ge‐
zeugten Geisteswesenheiten offenbaren kann. ‒ ‒
in unermeßlichen Räumen, wollte sie je in höch‐
sten geistigen Sphären ihrem Gotte begegnen. ‒ ‒
Menschheitslehrer, würden die Bilder Gottes, die
sie gestalten, nur einem «Gotte» gelten, der da als
«höchstes Wesen» über anderen Geisteswesenheiten
thront. ‒ ‒
.So wie man an keiner Stelle der Erde der reinen
Elektrizität begegnen kann, und doch alles auf die‐
ser Erde durchströmt wird von dieser Kraft, so auch
ist es in allen Geistes-Sphären ewig unmöglich,
Gott zu begegnen, obwohl alles, was da lebt, nur im
Dasein ist, als Ausdruck von Gottes ewig zeugender
Darstellungs-Gewalt. ‒
.Wie aber Elektrizität gewisse Apparate braucht,
um durch diese Apparate sichtbar und erkennbar
zu werden, so auch ist Gott in Zeit und Ewigkeit
nur in jenen Geisteswesenheiten sichtbar und er‐
kennbar, die mit der Kraft Gottes völlig vereint,
zum lautersten Ausdruck von Gottes Wesen wur‐
den. ‒
.Wer zur Theo-Sophia, zum «Wissen» um Gott ge‐
langen will, der muß vor allem diese Grundtatsache
begriffen haben. ‒ ‒
.Aus ihr aber ergibt sich folgerichtig das Wissen
um die Notwendigkeit solcher Menschengeister auf
dieser Erde, in denen die Gottheit sich selbst leben‐
digen Ausdruck schuf, damit sie allen Menschengei‐
stern erkennbar werde, auf daß alle jene Vereinung
erstreben, durch die der Menschengeist aus Gott
verherrlicht wird...
thront. ‒ ‒
Elektrizität begegnen kann, und doch alles auf die‐
ser Erde durchströmt wird von dieser Kraft, so auch
ist es in allen Geistes-Sphären ewig unmöglich,
Gott zu begegnen, obwohl alles, was da lebt, nur im
Dasein ist, als Ausdruck von Gottes ewig zeugender
Darstellungs-Gewalt. ‒
um durch diese Apparate sichtbar und erkennbar
zu werden, so auch ist Gott in Zeit und Ewigkeit
nur in jenen Geisteswesenheiten sichtbar und er‐
kennbar, die mit der Kraft Gottes völlig vereint,
zum lautersten Ausdruck von Gottes Wesen wur‐
den. ‒
langen will, der muß vor allem diese Grundtatsache
begriffen haben. ‒ ‒
um die Notwendigkeit solcher Menschengeister auf
dieser Erde, in denen die Gottheit sich selbst leben‐
digen Ausdruck schuf, damit sie allen Menschengei‐
stern erkennbar werde, auf daß alle jene Vereinung
erstreben, durch die der Menschengeist aus Gott
verherrlicht wird...
.Nichts anderes als diese völlig der Gottheit
geeinten Menschengeister dieser Erde sind aber
die eigentlichen «Meister» der «Weißen Loge», von
denen leider ein Zerrbild existiert, das ihr wah‐
res, kosmisch bedingtes Wesen gröblich ver‐
fälscht. ‒ ‒ ‒
.Wie jeder Menschengeist, der je auf der Erde er‐
schien oder noch erscheinen wird, so sind auch sie
vor Äonen, als diese Erde noch nicht eimal «Wel‐
tenstaub» war, dem «Falle» der Geister, gleich al‐
len anderen erlegen. Gleich allen andern erwar‐
teten sie ihre Zeit, um sich mit dem Menschen‐
tiere der Erde zu irdischem Leben zu verbinden,
mit der Aufgabe, dieses Menschentieres höhere
Kräfte zu erlösen, und durch diese Erlösertat
selbst Erlösung zu finden...
.Doch, höhere Geisteswesenheiten wußten aus
geistigem, gottgeeinten «Wissen», daß keiner der
diesem Erdentiere Verbundenen jemals zur Erlö‐
sung kommen könne ohne ihre Hilfe, und geistiges
«Wissen» läßt keine Wahl, wird Verpflichtung, ver‐
langt gesetzliche Tat, sobald eine Möglichkeit zur
Hilfe gegeben ist. ‒
.So suchten sich jene höheren Geisteswesenhei‐
ten aus der Fülle harrender Geister, die sich auf
Erden dem Menschentiere verbinden mußten,
geeinten Menschengeister dieser Erde sind aber
die eigentlichen «Meister» der «Weißen Loge», von
denen leider ein Zerrbild existiert, das ihr wah‐
res, kosmisch bedingtes Wesen gröblich ver‐
fälscht. ‒ ‒ ‒
schien oder noch erscheinen wird, so sind auch sie
vor Äonen, als diese Erde noch nicht eimal «Wel‐
tenstaub» war, dem «Falle» der Geister, gleich al‐
len anderen erlegen. Gleich allen andern erwar‐
teten sie ihre Zeit, um sich mit dem Menschen‐
tiere der Erde zu irdischem Leben zu verbinden,
mit der Aufgabe, dieses Menschentieres höhere
Kräfte zu erlösen, und durch diese Erlösertat
selbst Erlösung zu finden...
geistigem, gottgeeinten «Wissen», daß keiner der
diesem Erdentiere Verbundenen jemals zur Erlö‐
sung kommen könne ohne ihre Hilfe, und geistiges
«Wissen» läßt keine Wahl, wird Verpflichtung, ver‐
langt gesetzliche Tat, sobald eine Möglichkeit zur
Hilfe gegeben ist. ‒
ten aus der Fülle harrender Geister, die sich auf
Erden dem Menschentiere verbinden mußten,
jene aus, die sich aus freiem Willen bereit finden
ließen, das Hilfswerk dieser höheren Geisteswesen‐
heiten zu fördern, da diese selbst, ihrer Artung nach,
mit dem im Tiere gebundenen Menschengeiste
keine direkte Berührung schaffen konnten. ‒
.Die Bereitschaft, diesen höheren Geisteswesen‐
heiten als Vermittlungswerkzeug zu dienen,
schloß die Bereitschaft in sich, eine Jahrtausende
dauernde geistige Vorbereitung durchzuleben und
so erst Jahrtausende später zur Inkarnation zu ge‐
langen. ‒ ‒ ‒
.Darum läßt sich mit Fug und Recht von den
wirklichen «Meistern» der «Weißen Loge» als von
den älteren Brüdern der heute lebenden Mensch‐
heit reden. ‒ ‒ ‒
.Es ist aber ebenso irrig, sie für eine Art über‐
menschlicher Wesen zu halten, wie es irrig ist, sie
mit Fakiren und Dschungelheiligen zu verwech‐
seln. ‒
.Sie betreiben auch keinerlei Mantik und entsa‐
gen allen okkulten Künsten. ‒
.Sie wissen auf weitaus bedeutendere Art in der
Menschheit zum Guten zu wirken, ohne jemals als
Urheber dieses Wirkens offenbar zu werden. ‒
ließen, das Hilfswerk dieser höheren Geisteswesen‐
heiten zu fördern, da diese selbst, ihrer Artung nach,
mit dem im Tiere gebundenen Menschengeiste
keine direkte Berührung schaffen konnten. ‒
heiten als Vermittlungswerkzeug zu dienen,
schloß die Bereitschaft in sich, eine Jahrtausende
dauernde geistige Vorbereitung durchzuleben und
so erst Jahrtausende später zur Inkarnation zu ge‐
langen. ‒ ‒ ‒
wirklichen «Meistern» der «Weißen Loge» als von
den älteren Brüdern der heute lebenden Mensch‐
heit reden. ‒ ‒ ‒
menschlicher Wesen zu halten, wie es irrig ist, sie
mit Fakiren und Dschungelheiligen zu verwech‐
seln. ‒
gen allen okkulten Künsten. ‒
Menschheit zum Guten zu wirken, ohne jemals als
Urheber dieses Wirkens offenbar zu werden. ‒
.Ihr Wirken ist lediglich geistiger Art, und Irdi‐
sches wird von ihnen nur bewegt, von jenen gött‐
lich-geistigen Welten her, in denen ihr Wirken aus
Gott allein erfolgt. ‒ ‒ ‒
.Eine Theo-Sophia außerhalb der Einflußwir‐
kungen dieser gottgeeinten Menschengeister, die
hier im Erdenkörper die Last des Erdenlebens
tragen wie jeder andere Menschengeist, ist ein Un‐
ding! ‒
.Absurd und jeder Logik bar ist jedes «theoso‐
phische» Streben, das jene Wenigen auf dieser
Erde zu umgehen sucht, die allein ihm helfen kön‐
nen.
.Kindlich ist aber hinwieder auch die Annahme,
man könne jemals zu einem «Meister» der «Wei‐
ßen Loge» werden. ‒
.Man kann wohl die gleiche, göttlich-geistige Ei‐
nigung erlangen, aber niemals wird man jene Kräfte
zu eigen erhalten, die erst den «Meister» der
«Weißen Loge» zu dem machen, was er potentiell vor
seiner Inkarnation schon war. ‒ ‒ ‒
.Man darf freilich auch nicht glauben, daß jene
Gestalten, die um die Wiege der «Theosophischen
Gesellschaft» herum gespensterten, etwa wirkliche
«Meister» der «Weißen Loge» gewesen wären ‒ ‒
sches wird von ihnen nur bewegt, von jenen gött‐
lich-geistigen Welten her, in denen ihr Wirken aus
Gott allein erfolgt. ‒ ‒ ‒
kungen dieser gottgeeinten Menschengeister, die
hier im Erdenkörper die Last des Erdenlebens
tragen wie jeder andere Menschengeist, ist ein Un‐
ding! ‒
phische» Streben, das jene Wenigen auf dieser
Erde zu umgehen sucht, die allein ihm helfen kön‐
nen.
man könne jemals zu einem «Meister» der «Wei‐
ßen Loge» werden. ‒
nigung erlangen, aber niemals wird man jene Kräfte
zu eigen erhalten, die erst den «Meister» der
«Weißen Loge» zu dem machen, was er potentiell vor
seiner Inkarnation schon war. ‒ ‒ ‒
Gestalten, die um die Wiege der «Theosophischen
Gesellschaft» herum gespensterten, etwa wirkliche
«Meister» der «Weißen Loge» gewesen wären ‒ ‒
aber an dieser Stelle meiner Rede fürchte ich
doch noch, daß so mancher Leser dieser Zeit‐
schrift es nur schwer ertragen könnte, wollte ich
so, wie es berechtigt wäre, unsanft das Spinnen‐
netz seines Glaubenswahns zerstören, und darum
möge hier nur auf gewisse Kapitel eines dem‐
nächst erscheinenden Buches* verwiesen werden,
die im Vorabdruck bereits in den «Magischen
Blättern», von denen ich oben sprach, zu lesen
waren...
.Auf dieser Erde kann jegliches Geschehen sich
oft Jahrzehnte lang in Verdunkelung verbergen,
aber die Wahrheit kommt dennoch eines Tages
schrill und klirrend an unser Ohr, und was sich
noch so lange im Dämmerdunkel verbarg, muß
eines Tages helles Sonnenlicht ertragen, mag
auch so manches Wundermärchen auf solche
Weise seinen Untergang finden. ‒ ‒ ‒
.Es wäre mir Anlaß zu tiefem, schmerzlichem
Bedauern, sollte einst solche Klärung der Ge‐
schehnisse, die sich in den Säuglingszeiten der
«Theosophischen Gesellschaft» abspielten, dieser
Gesellschaft, so wie sie heute ist, und wie sie speziell
vom «Hauptquartier» in Leipzig aufgefaßt und ver‐
doch noch, daß so mancher Leser dieser Zeit‐
schrift es nur schwer ertragen könnte, wollte ich
so, wie es berechtigt wäre, unsanft das Spinnen‐
netz seines Glaubenswahns zerstören, und darum
möge hier nur auf gewisse Kapitel eines dem‐
nächst erscheinenden Buches* verwiesen werden,
die im Vorabdruck bereits in den «Magischen
Blättern», von denen ich oben sprach, zu lesen
waren...
oft Jahrzehnte lang in Verdunkelung verbergen,
aber die Wahrheit kommt dennoch eines Tages
schrill und klirrend an unser Ohr, und was sich
noch so lange im Dämmerdunkel verbarg, muß
eines Tages helles Sonnenlicht ertragen, mag
auch so manches Wundermärchen auf solche
Weise seinen Untergang finden. ‒ ‒ ‒
Bedauern, sollte einst solche Klärung der Ge‐
schehnisse, die sich in den Säuglingszeiten der
«Theosophischen Gesellschaft» abspielten, dieser
Gesellschaft, so wie sie heute ist, und wie sie speziell
vom «Hauptquartier» in Leipzig aufgefaßt und ver‐
* Mehr Licht (1921; erweiterte endgültige Ausgabe 1936, 1968 und 1989)
treten wird, Schaden zufügen, und darum halte
ich es für meine Pflicht, darauf hinzuweisen, daß
die Dinge damals nicht ganz so lagen, wie sie die
Gründerin der Gesellschaft zu sehen und darzu‐
stellen beliebte. ‒ ‒ ‒
.Töricht und ungerecht wäre es aber, der «theo‐
sophischen Gesellschaft» unserer Tage daraus ir‐
gendeinen Vorwurf konstruieren zu wollen, oder
die heutigen Mitglieder verantwortlich zu ma‐
chen für Irrtümer und Fehler der einstigen
Gründerin.
.Es unterliegt bei mir keinem Zweifel, daß eine
wahrhaft «theosophische» Gesellschaft heute tiefste
Lebensberechtigung hat und es ist heute völlig
gleichgültig, welche Anlässe vor Jahrzehnten zur
Gründung einer solchen Gesellschaft führten,
wenn nur das heutige Wirken der Gesellschaft
als einwandfrei und vorbildlich betrachtet werden
darf. ‒
.Die Grundlagen wahrer Theo-Sophia bleiben für
alle Zeiten die gleichen.
.Auch die heutige «Theosophische Gesellschaft»
vermag es, auf ihnen das innerste Sanktuarium ihres
weiträumigen Tempels zu errichten.
ich es für meine Pflicht, darauf hinzuweisen, daß
die Dinge damals nicht ganz so lagen, wie sie die
Gründerin der Gesellschaft zu sehen und darzu‐
stellen beliebte. ‒ ‒ ‒
sophischen Gesellschaft» unserer Tage daraus ir‐
gendeinen Vorwurf konstruieren zu wollen, oder
die heutigen Mitglieder verantwortlich zu ma‐
chen für Irrtümer und Fehler der einstigen
Gründerin.
wahrhaft «theosophische» Gesellschaft heute tiefste
Lebensberechtigung hat und es ist heute völlig
gleichgültig, welche Anlässe vor Jahrzehnten zur
Gründung einer solchen Gesellschaft führten,
wenn nur das heutige Wirken der Gesellschaft
als einwandfrei und vorbildlich betrachtet werden
darf. ‒
alle Zeiten die gleichen.
vermag es, auf ihnen das innerste Sanktuarium ihres
weiträumigen Tempels zu errichten.
.Die Erkenntnis der Auswirkung Gottes, das
«Wissen» daß Gott nur in den ihm völlig geeinten,
geistesmenschlichen Wesenheiten offenbarend
wirkt, das «Wissen», daß ein jeglicher Mensch die‐
ser Erde imstande ist, sich seinem ewigen Urbild,
seinem «Vater im Himmel», seinem «lebendigen
Gotte» anzugleichen und sich ihm mit seinem Be‐
wußtsein zu vereinen, das «Wissen», daß ohne die
stetige geistige Hilfe höherer geistiger Wesenhei‐
ten, vermittelt durch die «Meister» der «Weißen
Loge», diese Vereinigung des menschlichen mit
dem göttlichen Bewußtsein unmöglich wäre ‒ dies
sind die hauptsächlichsten Fundamentsteine, auf
denen sich das unantastbare Tempelkultbild erhe‐
ben muß, um das sich die Mitglieder der «Theosophi‐
schen Gesellschaft» erhobenen Herzens stets scha‐
ren können, ohne jemals befürchten zu müssen,
daß die Gottheit solchen Ort der Weihe nicht als
ihrer würdig betrachten möge! ‒ ‒ ‒
.Theoretische Erörterungen über hellseheri‐
sche «Forschungen» auf «höheren» Ebenen sind
völlig überflüssig, einmal, weil kein Hellseher je‐
mals zu «höheren» Ebenen emporzudringen im‐
stande ist, und dann: weil alles Wissen über geistige
Zustände nichts nützt, nur eitle Befriedigung kin‐
discher Neugier bleibt, solange man nicht, mit
dem Bewußtsein des lebendigen Gottes in sich
«Wissen» daß Gott nur in den ihm völlig geeinten,
geistesmenschlichen Wesenheiten offenbarend
wirkt, das «Wissen», daß ein jeglicher Mensch die‐
ser Erde imstande ist, sich seinem ewigen Urbild,
seinem «Vater im Himmel», seinem «lebendigen
Gotte» anzugleichen und sich ihm mit seinem Be‐
wußtsein zu vereinen, das «Wissen», daß ohne die
stetige geistige Hilfe höherer geistiger Wesenhei‐
ten, vermittelt durch die «Meister» der «Weißen
Loge», diese Vereinigung des menschlichen mit
dem göttlichen Bewußtsein unmöglich wäre ‒ dies
sind die hauptsächlichsten Fundamentsteine, auf
denen sich das unantastbare Tempelkultbild erhe‐
ben muß, um das sich die Mitglieder der «Theosophi‐
schen Gesellschaft» erhobenen Herzens stets scha‐
ren können, ohne jemals befürchten zu müssen,
daß die Gottheit solchen Ort der Weihe nicht als
ihrer würdig betrachten möge! ‒ ‒ ‒
sche «Forschungen» auf «höheren» Ebenen sind
völlig überflüssig, einmal, weil kein Hellseher je‐
mals zu «höheren» Ebenen emporzudringen im‐
stande ist, und dann: weil alles Wissen über geistige
Zustände nichts nützt, nur eitle Befriedigung kin‐
discher Neugier bleibt, solange man nicht, mit
dem Bewußtsein des lebendigen Gottes in sich
selbst vereint, selbst fähig wurde, die Wunder gei‐
stiger Welten geistig zu erleben.
.Auf das geistige Erlebnis hin muß die «Theosophi‐
sche Gesellschaft» ihre Mitglieder erziehen, damit
ihr Tempel nicht zur Stätte wüstester Spekulation
entarte, damit er ein Heiligtum geistigen Lebens
bilde, inmitten der ausgetrockneten Wüste dür‐
ren Gedankenflugsandes, der auch die erhaben‐
sten Tempelbauten früherer Zeiten allmählich zu
verschütten droht. ‒ ‒ ‒
.Möchten meine Worte offene Herzen fin‐
den! ‒ ‒ ‒
stiger Welten geistig zu erleben.
sche Gesellschaft» ihre Mitglieder erziehen, damit
ihr Tempel nicht zur Stätte wüstester Spekulation
entarte, damit er ein Heiligtum geistigen Lebens
bilde, inmitten der ausgetrockneten Wüste dür‐
ren Gedankenflugsandes, der auch die erhaben‐
sten Tempelbauten früherer Zeiten allmählich zu
verschütten droht. ‒ ‒ ‒
den! ‒ ‒ ‒
W I E kürzlich zu lesen war, beschäftigt man
sich zurzeit im Pariser Psychologischen Institut
mit einem weiblichen «Medium», in dessen An‐
wesenheit sich ein Tisch frei in die Luft erhebt,
ohne auch nur von dem Medium berührt zu wer‐
den. Eine solche Art der Mediumschaft ist aller‐
dings schon ziemlich selten, und es lohnt sich
zweifellos, die Manifestationen zu beobachten.
Prof. Bertrard, der die junge Dame einem gelehr‐
ten Kreise vorführte, ist nun ein vorurteilsfreier
Forscher, der doch erst wissenschaftlich prüfen
möchte, wo andere ‒ man vergleiche nur Eduard
von Hartmann ‒ frisch drauflos urteilen und dabei
selbst gestehen, niemals bei ähnlichen Manifesta‐
tionen zugegen gewesen zu sein. ‒
.In der Pressenotiz, die über die Experimente
mit dem Pariser Medium berichtet, heißt es zum
Schluß: «Verwunderlich scheint dem Laien aller‐
dings, daß das Mädchen nur bei gedämpftem, ro‐
safarbenen Lichte operieren kann, während weis‐
sich zurzeit im Pariser Psychologischen Institut
mit einem weiblichen «Medium», in dessen An‐
wesenheit sich ein Tisch frei in die Luft erhebt,
ohne auch nur von dem Medium berührt zu wer‐
den. Eine solche Art der Mediumschaft ist aller‐
dings schon ziemlich selten, und es lohnt sich
zweifellos, die Manifestationen zu beobachten.
Prof. Bertrard, der die junge Dame einem gelehr‐
ten Kreise vorführte, ist nun ein vorurteilsfreier
Forscher, der doch erst wissenschaftlich prüfen
möchte, wo andere ‒ man vergleiche nur Eduard
von Hartmann ‒ frisch drauflos urteilen und dabei
selbst gestehen, niemals bei ähnlichen Manifesta‐
tionen zugegen gewesen zu sein. ‒
mit dem Pariser Medium berichtet, heißt es zum
Schluß: «Verwunderlich scheint dem Laien aller‐
dings, daß das Mädchen nur bei gedämpftem, ro‐
safarbenen Lichte operieren kann, während weis‐
ses und blaues Licht seine Kraft lähmt und das
Aufblitzen von Magnesiumlicht ihm sogar einen
Nervenschock verursachte. Sollte es am Ende
doch Grund haben, hellere Lichtgattungen zu
scheuen?»
.Das erinnert mich lebhaft an die schöne Ge‐
schichte von dem Mandarinen, dem zur Zeit des
ersten Aufkommens der Photographie ein euro‐
päischer Gelehrter begreiflich machen wollte, daß
lediglich die Lichtstrahlen solche Bilder malten.
Der chinesische Würdenträger aber ließ sich dar‐
aufhin also vernehmen: «Ja, wenn du das, was du
da in der Dunkelkammer treibst, mir bei hellem Son‐
nenlicht zeigen willst, dann werde ich dir gerne
glauben, vorher aber nicht!»
.Gewiß hat das Medium «hellere Lichtgattungen
zu scheuen», aber wenn es ein echtes Medium ist,
wenn also kein Schwindelmanöver vorliegt, was
bei den gelehrten Untersuchungen des Prof. Ber‐
trard doch wohl als ausgeschlossen gelten dürfte,
dann hat es helleres Licht in keiner anderen
Weise «zu scheuen», wie der Photograph, der sich
auch außerstande sehen würde, ein gutes Licht‐
bild zu fertigen, wollte man ihm die Bedingung
stellen, die Entwicklung der Platte bei hellem Ta‐
geslicht vorzunehmen. ‒
Aufblitzen von Magnesiumlicht ihm sogar einen
Nervenschock verursachte. Sollte es am Ende
doch Grund haben, hellere Lichtgattungen zu
scheuen?»
schichte von dem Mandarinen, dem zur Zeit des
ersten Aufkommens der Photographie ein euro‐
päischer Gelehrter begreiflich machen wollte, daß
lediglich die Lichtstrahlen solche Bilder malten.
Der chinesische Würdenträger aber ließ sich dar‐
aufhin also vernehmen: «Ja, wenn du das, was du
da in der Dunkelkammer treibst, mir bei hellem Son‐
nenlicht zeigen willst, dann werde ich dir gerne
glauben, vorher aber nicht!»
zu scheuen», aber wenn es ein echtes Medium ist,
wenn also kein Schwindelmanöver vorliegt, was
bei den gelehrten Untersuchungen des Prof. Ber‐
trard doch wohl als ausgeschlossen gelten dürfte,
dann hat es helleres Licht in keiner anderen
Weise «zu scheuen», wie der Photograph, der sich
auch außerstande sehen würde, ein gutes Licht‐
bild zu fertigen, wollte man ihm die Bedingung
stellen, die Entwicklung der Platte bei hellem Ta‐
geslicht vorzunehmen. ‒
.Dennoch aber werden diese neuen Pariser Ex‐
perimente, wie so viele andere vorher, nur sehr
fragmentarische Lösungen des Rätsels bringen,
aber das liegt nicht etwa an der Fragwürdigkeit
der Phänomene, sondern daran, daß man hier
mit einer Wesenreihe experimentiert, von deren
Vorhandensein man keine Ahnung hat; und wäh‐
rend man mit Recht die läppische Hypothese, es
handle sich da um Äußerungen «unserer lieben
Verstorbenen», von vornherein fallen läßt, be‐
geht man nach der anderen Seite hin doch den
gleichen Fehler, indem man als gesichert annimmt,
daß es keinerlei außermenschliche, unsichtbare
Wesen geben könne. ‒ ‒
.Nun muß, wie auch bei den Experimenten von
Ochorowitz, das «Mädchen für alles», der soge‐
nannte «Animismus» herhalten, obwohl es da gar
keine präzise Kontrolle geben kann, durch die
festzustellen wäre, wo «animistische» Wirkungen
aufhören und wo «spiritistische» beginnen; denn
die Kräfte der «Anima», der «Seele» des Mediums,
sind ja im sogenannten Trancezustand, mag er
nun vollendet oder nur teilweise vorliegen, völlig je‐
ner unsichtbaren Wesenreihe ausgeliefert, deren
Existenz man von vornherein leugnen zu dürfen
glaubt. ‒ ‒
perimente, wie so viele andere vorher, nur sehr
fragmentarische Lösungen des Rätsels bringen,
aber das liegt nicht etwa an der Fragwürdigkeit
der Phänomene, sondern daran, daß man hier
mit einer Wesenreihe experimentiert, von deren
Vorhandensein man keine Ahnung hat; und wäh‐
rend man mit Recht die läppische Hypothese, es
handle sich da um Äußerungen «unserer lieben
Verstorbenen», von vornherein fallen läßt, be‐
geht man nach der anderen Seite hin doch den
gleichen Fehler, indem man als gesichert annimmt,
daß es keinerlei außermenschliche, unsichtbare
Wesen geben könne. ‒ ‒
Ochorowitz, das «Mädchen für alles», der soge‐
nannte «Animismus» herhalten, obwohl es da gar
keine präzise Kontrolle geben kann, durch die
festzustellen wäre, wo «animistische» Wirkungen
aufhören und wo «spiritistische» beginnen; denn
die Kräfte der «Anima», der «Seele» des Mediums,
sind ja im sogenannten Trancezustand, mag er
nun vollendet oder nur teilweise vorliegen, völlig je‐
ner unsichtbaren Wesenreihe ausgeliefert, deren
Existenz man von vornherein leugnen zu dürfen
glaubt. ‒ ‒
.Wie man vielleicht aus gewissen früheren Ab‐
handlungen wissen wird, warne ich stets entschie‐
den vor sogenannten «spiritistischen» Experi‐
menten. Ich rate auch hier wieder jedem meiner
Mitmenschen, der etwa «mediale» Fähigkeiten an
sich bemerkt und sich dadurch vielleicht gar noch
besonders «begnadet» glaubt, sich so schnell als
nur möglich dem Spinnengewebe, das ihn zu
umschnüren droht, zu entwinden. Das ist jeder‐
zeit möglich durch entschiedene Aktivität, durch
ein Aufsuchen gesunder Lebensbedingungen
in freier Natur und durch ein grundsätzliches
Vermeiden jeder geistigen Atmosphäre, in der
die «mediale» Veranlagung gefördert werden
könnte. Man vergesse nicht, daß jedes echte «Me‐
dium» ein unglückliches Opfer sehr bedenklicher
und niemals von ihm zu erkennender Wesen ist,
Wesen, die zur physischen Welt gehören, auch
wenn sie für uns unsichtbar bleiben, und die für
das Leben der Seele Parasiten darstellen, wie Ba‐
zillen und Mikroben für das Leben des physi‐
schen Körpers! ‒ Diese Parasiten saugen ihr Op‐
fer aus bis zum letzten Rest seiner feineren physi‐
schen Kräfte, die dem Willen und dem Seelenleben
dienen sollten, bis sie es schließlich zerbrochen
am Wege liegen lassen, so hochmoralisch auch die
«Bekundungen der Geisterwelt» vielleicht vorher
waren. ‒
handlungen wissen wird, warne ich stets entschie‐
den vor sogenannten «spiritistischen» Experi‐
menten. Ich rate auch hier wieder jedem meiner
Mitmenschen, der etwa «mediale» Fähigkeiten an
sich bemerkt und sich dadurch vielleicht gar noch
besonders «begnadet» glaubt, sich so schnell als
nur möglich dem Spinnengewebe, das ihn zu
umschnüren droht, zu entwinden. Das ist jeder‐
zeit möglich durch entschiedene Aktivität, durch
ein Aufsuchen gesunder Lebensbedingungen
in freier Natur und durch ein grundsätzliches
Vermeiden jeder geistigen Atmosphäre, in der
die «mediale» Veranlagung gefördert werden
könnte. Man vergesse nicht, daß jedes echte «Me‐
dium» ein unglückliches Opfer sehr bedenklicher
und niemals von ihm zu erkennender Wesen ist,
Wesen, die zur physischen Welt gehören, auch
wenn sie für uns unsichtbar bleiben, und die für
das Leben der Seele Parasiten darstellen, wie Ba‐
zillen und Mikroben für das Leben des physi‐
schen Körpers! ‒ Diese Parasiten saugen ihr Op‐
fer aus bis zum letzten Rest seiner feineren physi‐
schen Kräfte, die dem Willen und dem Seelenleben
dienen sollten, bis sie es schließlich zerbrochen
am Wege liegen lassen, so hochmoralisch auch die
«Bekundungen der Geisterwelt» vielleicht vorher
waren. ‒
Das Ende fast aller sogenannten «Medien» ist
entweder ein Versinken in willenlose moralische Ver‐
worfenheit, oder ‒ in die Nacht des Wahnsinns!
.Es ist wahrlich notwendig, vor einer solchen
Seuche, die gerade jetzt wieder besonders stark
grassiert, eindringlichst zu warnen, auch wenn
die von dieser psychischen Pest Ergriffenen ent‐
rüstet sein mögen, da sie sich ja doch für «er‐
wählte Werkzeuge höherer Mächte», für die
«Mittler zwischen Diesseits und Jenseits», ja für
die eigentlichen «Sprachrohre Gottes» halten und
mit hirnverbrannter Kritiklosigkeit immer wie‐
der den erhabenen Meister von Nazareth als «das
größte Medium» proklamieren. ‒
.Wenn ich aber, aus einer Kenntnis der Dinge
heraus, wie sie nur wenigen Lebenden möglich
wurde, so entschieden vor jeder «spiritistischen»
Betätigung, vor jedem Glauben an «spiritistische»
Orakelei warnen muß, so darf man gewiß schon
daraus ersehen, daß die mir in jeder ihrer Auswir‐
kungsarten bis ins kleinste bekannten «spiritisti‐
schen« Phänomene als solche durchaus realen Gege‐
benheiten entsprechen. Nur Ignoranz kann das Dasein
dieser Phänomene deshalb leugnen, weil es zu al‐
ler Zeit gerissene Schwindler gab, die aus der
Neugierde ihrer Mitmenschen auf ihre Art Vor‐
teil zogen, indem sie die möglichen echten Phäno‐
entweder ein Versinken in willenlose moralische Ver‐
worfenheit, oder ‒ in die Nacht des Wahnsinns!
Seuche, die gerade jetzt wieder besonders stark
grassiert, eindringlichst zu warnen, auch wenn
die von dieser psychischen Pest Ergriffenen ent‐
rüstet sein mögen, da sie sich ja doch für «er‐
wählte Werkzeuge höherer Mächte», für die
«Mittler zwischen Diesseits und Jenseits», ja für
die eigentlichen «Sprachrohre Gottes» halten und
mit hirnverbrannter Kritiklosigkeit immer wie‐
der den erhabenen Meister von Nazareth als «das
größte Medium» proklamieren. ‒
heraus, wie sie nur wenigen Lebenden möglich
wurde, so entschieden vor jeder «spiritistischen»
Betätigung, vor jedem Glauben an «spiritistische»
Orakelei warnen muß, so darf man gewiß schon
daraus ersehen, daß die mir in jeder ihrer Auswir‐
kungsarten bis ins kleinste bekannten «spiritisti‐
schen« Phänomene als solche durchaus realen Gege‐
benheiten entsprechen. Nur Ignoranz kann das Dasein
dieser Phänomene deshalb leugnen, weil es zu al‐
ler Zeit gerissene Schwindler gab, die aus der
Neugierde ihrer Mitmenschen auf ihre Art Vor‐
teil zogen, indem sie die möglichen echten Phäno‐
mene auf mehr oder weniger geschickte Art vorzu‐
gaukeln suchten und so ihre Gläubigen oft lange
Zeit hindurch um deren «schnöden Mammon»
erleichterten, bis eines Tages die «Entlarvung»
dem Treiben ein Ende setzte.
.Das Vorhandensein der echten Phänomene d. Spiri‐
tismus steht, trotzdem auch oft echte Medien sich zu
gelegentlichen Schwindeleien hinreißen lassen,
und je mehr ihre Kräfte ausgesaugt sind, desto
häufiger ‒ so außer allem Zweifel, wie das Dasein der
Röntgenstrahlen, nur werden sie sich niemals wie
diese erforschen lassen, eben weil es sich nicht le‐
diglich um physikalische Kräfte handelt, sondern weil
hier uns zum Teil unbekannte physikalische
Kräfte durch eine Art von Wesen in Aktion gesetzt
werden, die ihren eigenen Willensimpulsen folgen
und keineswegs gesonnen sind, unsern Wissens‐
trieb wirklich zu befriedigen.
.Diese Zwischenwesen, auf deren Dasein wohl so
manche Gestalt aus der Vorstellungswelt des Mär‐
chens und früherer Sagen zurückgehen mag,
sind durchaus amoralisch, weder gut noch böse,
folgen allein einem Triebe, den man bei Men‐
schen etwa «Laune» nennen würde ‒ kennen kei‐
nerlei «Gewissen» und sind einzig darauf bedacht,
sich mit Hilfe solcher Menschen, deren psycho‐
physischer Organismus krankhaft gelockert ist,
gaukeln suchten und so ihre Gläubigen oft lange
Zeit hindurch um deren «schnöden Mammon»
erleichterten, bis eines Tages die «Entlarvung»
dem Treiben ein Ende setzte.
tismus steht, trotzdem auch oft echte Medien sich zu
gelegentlichen Schwindeleien hinreißen lassen,
und je mehr ihre Kräfte ausgesaugt sind, desto
häufiger ‒ so außer allem Zweifel, wie das Dasein der
Röntgenstrahlen, nur werden sie sich niemals wie
diese erforschen lassen, eben weil es sich nicht le‐
diglich um physikalische Kräfte handelt, sondern weil
hier uns zum Teil unbekannte physikalische
Kräfte durch eine Art von Wesen in Aktion gesetzt
werden, die ihren eigenen Willensimpulsen folgen
und keineswegs gesonnen sind, unsern Wissens‐
trieb wirklich zu befriedigen.
manche Gestalt aus der Vorstellungswelt des Mär‐
chens und früherer Sagen zurückgehen mag,
sind durchaus amoralisch, weder gut noch böse,
folgen allein einem Triebe, den man bei Men‐
schen etwa «Laune» nennen würde ‒ kennen kei‐
nerlei «Gewissen» und sind einzig darauf bedacht,
sich mit Hilfe solcher Menschen, deren psycho‐
physischer Organismus krankhaft gelockert ist,
auf dem Gebiet der physischen Erscheinungswelt
zu manifestieren. ‒ Was aus ihren Manifestatio‐
nen erwächst, ist ihnen durchaus gleichgültig,
und es kümmert sie wenig, daß ihre Opfer
schließlich zugrunde gehen müssen. ‒
.Im Orient, wo die Kenntnis der okkulten Er‐
scheinungen bis ins graueste Altertum zurück‐
reicht, gab es stets und gibt es auch heute noch
Menschen, die nicht nur, wie unsere Medien, wil‐
lenlose Sklaven dieser Wesen sind, sondern sich ih‐
rer Hilfe bewußt zu bedienen wissen, sie durch ihre
ungemein trainierte Willenskraft beherrschen.
.Es sind jene «Fakire», über deren staunenerre‐
gende «Wunder» die bestbeglaubigtsten Berichte
vorliegen, die aber durchaus nicht mit jenen
«Büßern» zu verwechseln sind, von denen der
eine sich langsam zwischen vier Feuern rösten
läßt, während ein anderer es vermag, viele Jahre
lang kopfabwärts an einem Baume zu hängen
und dergleichen mehr.
.Auch mit den bekannten «indischen» Zirkus‐
künstlern und Taschenspielern haben natürlich
diese echten «Fakire» nicht das mindeste zu tun.
.Ich leugne durchaus nicht, daß es sehr seltene
Fälle gibt, in denen auch von Seiten entkörperter,
also nicht mehr auf der Erde lebender Menschen,
zu manifestieren. ‒ Was aus ihren Manifestatio‐
nen erwächst, ist ihnen durchaus gleichgültig,
und es kümmert sie wenig, daß ihre Opfer
schließlich zugrunde gehen müssen. ‒
scheinungen bis ins graueste Altertum zurück‐
reicht, gab es stets und gibt es auch heute noch
Menschen, die nicht nur, wie unsere Medien, wil‐
lenlose Sklaven dieser Wesen sind, sondern sich ih‐
rer Hilfe bewußt zu bedienen wissen, sie durch ihre
ungemein trainierte Willenskraft beherrschen.
gende «Wunder» die bestbeglaubigtsten Berichte
vorliegen, die aber durchaus nicht mit jenen
«Büßern» zu verwechseln sind, von denen der
eine sich langsam zwischen vier Feuern rösten
läßt, während ein anderer es vermag, viele Jahre
lang kopfabwärts an einem Baume zu hängen
und dergleichen mehr.
künstlern und Taschenspielern haben natürlich
diese echten «Fakire» nicht das mindeste zu tun.
Fälle gibt, in denen auch von Seiten entkörperter,
also nicht mehr auf der Erde lebender Menschen,
diese hier besprochenen Wesen zur Manifestation
angetrieben werden, aber man glaube ja nicht,
auf normale Weise durch die Hilfe dieser Wesen
den erwünschten «Verkehr mit dem Jenseits» an‐
bahnen zu können!
.Die wenigen, denen die Natur dieser Wesen be‐
kannt ist und die sich ihrer bedienen könnten, weil
sie aus Gründen höherer übersinnlicher Entfal‐
tung einst diese Wesen überwinden mußten, hüten
sich wohl, von ihrer Macht Gebrauch zu machen,
ja, sie gehen für gewöhnlich diesen Wesen aus
dem Wege wie giftigen Schlangen.
.Auch wissenschaftlicher Forscherdrang er‐
scheint ihnen keineswegs entschuldbar, wenn er
dazu führt, den gefährlichen Bereich dieser Zwi‐
schenwelt aufzusuchen.
.Sie können nur immer wieder davor warnen,
diese dunklen und dem Menschen verderblichen
Gebiete der Allnatur vorwitzig zu betreten. ‒
.Niemals wird die Menschheit aus dem Zwi‐
schenreich her, dem die spiritistischen Phäno‐
mene entstammen, irgendeine Antwort erhalten,
die ihr auf die Dauer segensreich werden könnte.
.Torheit aber wäre es, seine Augen vor gesicher‐
ten Tatsachen verschließen zu wollen, die jederzeit
angetrieben werden, aber man glaube ja nicht,
auf normale Weise durch die Hilfe dieser Wesen
den erwünschten «Verkehr mit dem Jenseits» an‐
bahnen zu können!
kannt ist und die sich ihrer bedienen könnten, weil
sie aus Gründen höherer übersinnlicher Entfal‐
tung einst diese Wesen überwinden mußten, hüten
sich wohl, von ihrer Macht Gebrauch zu machen,
ja, sie gehen für gewöhnlich diesen Wesen aus
dem Wege wie giftigen Schlangen.
scheint ihnen keineswegs entschuldbar, wenn er
dazu führt, den gefährlichen Bereich dieser Zwi‐
schenwelt aufzusuchen.
diese dunklen und dem Menschen verderblichen
Gebiete der Allnatur vorwitzig zu betreten. ‒
schenreich her, dem die spiritistischen Phäno‐
mene entstammen, irgendeine Antwort erhalten,
die ihr auf die Dauer segensreich werden könnte.
ten Tatsachen verschließen zu wollen, die jederzeit
vorhanden waren, die so alt sind wie die Welt und
zu allen Zeiten, unter allen Völkern beobachtet
wurden, lange bevor Amerika, die Wiege des
neueren «Spiritismus», überhaupt entdeckt war.
.Wer hier noch zu leugnen versucht, der ist, um
mit Schopenhauer zu reden: ‒ «nicht ungläubig, son‐
dern unwissend zu nennen», ‒ aber wer gar Offen‐
barungen des ewigen Geistes bei spiritistischen Mani‐
festationen erwartet, der gleicht einem in der Wü‐
ste Verschmachtenden, der einer Luftspiegelung
nachläuft, die ihm schattige Oasen mit köstlichen
Quellen verspricht, während er durch seinen Irr‐
tum nur desto sicherer dem Verderben anheim‐
fällt, dem er entrinnen wollte. ‒
zu allen Zeiten, unter allen Völkern beobachtet
wurden, lange bevor Amerika, die Wiege des
neueren «Spiritismus», überhaupt entdeckt war.
mit Schopenhauer zu reden: ‒ «nicht ungläubig, son‐
dern unwissend zu nennen», ‒ aber wer gar Offen‐
barungen des ewigen Geistes bei spiritistischen Mani‐
festationen erwartet, der gleicht einem in der Wü‐
ste Verschmachtenden, der einer Luftspiegelung
nachläuft, die ihm schattige Oasen mit köstlichen
Quellen verspricht, während er durch seinen Irr‐
tum nur desto sicherer dem Verderben anheim‐
fällt, dem er entrinnen wollte. ‒
STIMMEN AUS DEM
«GEISTERREICHE»
«GEISTERREICHE»
SIE mehren sich wieder allerorten! Zwischen
hypermodernen Modedichtern und Salon‐
bolschewisten verzeichnen die Kataloge ge‐
schäftsgewandter Verleger eine Literatur, die mit
Prophetengeste sehr abgestandene Sensationen
von ehedem als «Allerneuestes» auftischt; und in
so mancher reputierlichen Familie sitzt man
halbe Nächte, um das Tischorakel zu befragen.
Männer und Frauen, die noch vor wenigen Jah‐
ren halb Verachtung, halb gelindes Grauen zeig‐
ten, wenn das Wort «Spiritismus» fiel, verharren
jetzt passiv am Schreibtisch und lassen sich von ih‐
ren «Freunden aus dem Jenseits» ehrfurchtsvoll
die Feder führen. Eine wahre Epidemie dieser Art
wütet im Lande, und sie ist um so gefährlicher,
weil fast alle, die von ihr erfaßt wurden, ihr Tun
sorglichst geheim zu halten suchen, so daß man in
Kreisen, die nicht selbst zu den Mitgerissenen ge‐
hören, auch nicht die leiseste Ahnung hat von der
erschreckenden Ausbreitung dieses Taumels.
hypermodernen Modedichtern und Salon‐
bolschewisten verzeichnen die Kataloge ge‐
schäftsgewandter Verleger eine Literatur, die mit
Prophetengeste sehr abgestandene Sensationen
von ehedem als «Allerneuestes» auftischt; und in
so mancher reputierlichen Familie sitzt man
halbe Nächte, um das Tischorakel zu befragen.
Männer und Frauen, die noch vor wenigen Jah‐
ren halb Verachtung, halb gelindes Grauen zeig‐
ten, wenn das Wort «Spiritismus» fiel, verharren
jetzt passiv am Schreibtisch und lassen sich von ih‐
ren «Freunden aus dem Jenseits» ehrfurchtsvoll
die Feder führen. Eine wahre Epidemie dieser Art
wütet im Lande, und sie ist um so gefährlicher,
weil fast alle, die von ihr erfaßt wurden, ihr Tun
sorglichst geheim zu halten suchen, so daß man in
Kreisen, die nicht selbst zu den Mitgerissenen ge‐
hören, auch nicht die leiseste Ahnung hat von der
erschreckenden Ausbreitung dieses Taumels.
.Als um die Mitte des vorigen Jahrhunderts die
neue Geisterkunde von Amerika her zu uns kam,
war die Wirkung weitaus harmloser. Abgesehen
von einigen schwärmerischen Enthusiasten und
allem Aberglauben freundlich gesinnten Eigen‐
brötlern, die sich nun in spiritistischen Zirkeln
fanden, beschäftigten sich wirklich ernsthaft mit
diesen Dingen nur wenige Männer der Wissen‐
schaft, stellten je nach Gelegenheit und Ausdauer
die Tatsächlichkeit der Phänomene oder auch
plumpen Schwindel daneben fest, kamen aber im
besten Falle ‒ wie etwa der Physiker Crookes ‒ nur
zu dem Schlusse, daß sie wohl das Wirken un‐
sichtbarer, anscheinend oder unbestreitbar von
Intelligenz geleiteter Kräfte beobachtet hätten,
daß aber keinerlei beweiskräftige Gründe dafür
aufzubieten seien, in diesen durch Intelligenz ge‐
leiteten Kräften wirklich, nach spiritistischer Hy‐
pothese, die weiterlebende Geistigkeit gestorbe‐
ner Menschen zu bestätigen.
.Was sonst vom damals neuen «Spiritismus» in
weitere Kreise drang, war Gesellschaftsspiel. In je‐
dem Mädchenpensionat war der tanzende Tisch
bekannt. Wo immer eine ausgelassene Gesellschaft
beisammen war, gehörte es zu den beliebtesten
Scherzen, den Tisch nach allem zu befragen, was
Heiterkeit und Laune fördern konnte.
neue Geisterkunde von Amerika her zu uns kam,
war die Wirkung weitaus harmloser. Abgesehen
von einigen schwärmerischen Enthusiasten und
allem Aberglauben freundlich gesinnten Eigen‐
brötlern, die sich nun in spiritistischen Zirkeln
fanden, beschäftigten sich wirklich ernsthaft mit
diesen Dingen nur wenige Männer der Wissen‐
schaft, stellten je nach Gelegenheit und Ausdauer
die Tatsächlichkeit der Phänomene oder auch
plumpen Schwindel daneben fest, kamen aber im
besten Falle ‒ wie etwa der Physiker Crookes ‒ nur
zu dem Schlusse, daß sie wohl das Wirken un‐
sichtbarer, anscheinend oder unbestreitbar von
Intelligenz geleiteter Kräfte beobachtet hätten,
daß aber keinerlei beweiskräftige Gründe dafür
aufzubieten seien, in diesen durch Intelligenz ge‐
leiteten Kräften wirklich, nach spiritistischer Hy‐
pothese, die weiterlebende Geistigkeit gestorbe‐
ner Menschen zu bestätigen.
weitere Kreise drang, war Gesellschaftsspiel. In je‐
dem Mädchenpensionat war der tanzende Tisch
bekannt. Wo immer eine ausgelassene Gesellschaft
beisammen war, gehörte es zu den beliebtesten
Scherzen, den Tisch nach allem zu befragen, was
Heiterkeit und Laune fördern konnte.
.So blieb der Spaß ungefährlich und ward als
überlebte Mode schließlich ganz vergessen.
.Die Zirkel der Schwärmer allein erhielten sich
auf dem Plan, und wenn auch die «Geistermani‐
festationen» meist über bald bekannt gewordene
physikalische und psychische Phänomene sich
nicht erhoben, wenn auch die «Offenbarungen»
der «Geister» selten über die trivialsten Phrasen
emporstiegen, so fehlte es doch bald nicht an spi‐
ritistischer Literatur, deren Berichte um so lieber
geglaubt wurden, je kritikloser sie abgefaßt wa‐
ren, und es nährten sich diese halb frömmelnden,
halb kirchenabgewandten Leutchen eben wie sie
sich heute noch nähren: ‒ durch gegenseitige
Stärkung ihrer frommen Wünsche, mehr aus Bü‐
chern als aus der Erfahrung.
.Auf über dreißigtausend «Bände» in allen Spra‐
chen beziffern die Spiritisten mehr oder minder
strenger Observanz ihre Literatur, wobei aller‐
dings die Vernünftigeren bedauernd zugeben,
daß das weitaus meiste obskures und wertloses
Zeug ist, oft nicht einmal von ehrlich Überzeug‐
ten verfaßt, nur der geschickten oder bloß
schlauen Ausnutzung der Konjunktur sein Da‐
sein dankend, geschrieben von Menschen, die ih‐
ren Beruf darin sehen, das jeweils Sensationelle
überlebte Mode schließlich ganz vergessen.
auf dem Plan, und wenn auch die «Geistermani‐
festationen» meist über bald bekannt gewordene
physikalische und psychische Phänomene sich
nicht erhoben, wenn auch die «Offenbarungen»
der «Geister» selten über die trivialsten Phrasen
emporstiegen, so fehlte es doch bald nicht an spi‐
ritistischer Literatur, deren Berichte um so lieber
geglaubt wurden, je kritikloser sie abgefaßt wa‐
ren, und es nährten sich diese halb frömmelnden,
halb kirchenabgewandten Leutchen eben wie sie
sich heute noch nähren: ‒ durch gegenseitige
Stärkung ihrer frommen Wünsche, mehr aus Bü‐
chern als aus der Erfahrung.
chen beziffern die Spiritisten mehr oder minder
strenger Observanz ihre Literatur, wobei aller‐
dings die Vernünftigeren bedauernd zugeben,
daß das weitaus meiste obskures und wertloses
Zeug ist, oft nicht einmal von ehrlich Überzeug‐
ten verfaßt, nur der geschickten oder bloß
schlauen Ausnutzung der Konjunktur sein Da‐
sein dankend, geschrieben von Menschen, die ih‐
ren Beruf darin sehen, das jeweils Sensationelle
aufzugreifen, um seine pekuniären Erfolgsmög‐
lichkeiten auszunutzen.
.Als Kaviar genießt man daneben in Behaglich‐
keit die ernsten Werke wissenschaftlicher Auto‐
ren, die über ihre Forschungsresultate berichten,
übernimmt aber jeweils nur solche Äußerungen,
die eigener Meinung als brauchbare Stütze er‐
scheinen, und übersieht in der großmütigen Ge‐
ste des Besserorientierten schlechthin alles, was
ein solcher Autor etwa an kritischen und negieren‐
den Einwänden gegen die spiritistische Lieblings‐
theorie zu sagen hat.
.Da die Anhängerschaft opferbereit ist zugun‐
sten der «guten Sache», und zu neun Zehnteln al‐
les aufnimmt, was der Büchermarkt nach ihrer
Richtung hin bringt, so wird hier noch jahraus,
jahrein recht beträchtliches Nationalvermögen
entwertet, zugunsten geschäftstüchtiger Zeitge‐
nossen, die stets für Befriedigung der Bedürf‐
nisse und neuen Anreiz sorgen, was von ihrem
Standpunkt her gesehen gewiß das Lob der Klug‐
heit verdient, hinsichtlich der Erhaltung und För‐
derung geistiger Volksgesundheit aber sicherlich
vom Übel ist.
.So verbreitet aber auch derartiges Konventikel‐
wesen verschiedener Schattierung in halbgebil‐
lichkeiten auszunutzen.
keit die ernsten Werke wissenschaftlicher Auto‐
ren, die über ihre Forschungsresultate berichten,
übernimmt aber jeweils nur solche Äußerungen,
die eigener Meinung als brauchbare Stütze er‐
scheinen, und übersieht in der großmütigen Ge‐
ste des Besserorientierten schlechthin alles, was
ein solcher Autor etwa an kritischen und negieren‐
den Einwänden gegen die spiritistische Lieblings‐
theorie zu sagen hat.
sten der «guten Sache», und zu neun Zehnteln al‐
les aufnimmt, was der Büchermarkt nach ihrer
Richtung hin bringt, so wird hier noch jahraus,
jahrein recht beträchtliches Nationalvermögen
entwertet, zugunsten geschäftstüchtiger Zeitge‐
nossen, die stets für Befriedigung der Bedürf‐
nisse und neuen Anreiz sorgen, was von ihrem
Standpunkt her gesehen gewiß das Lob der Klug‐
heit verdient, hinsichtlich der Erhaltung und För‐
derung geistiger Volksgesundheit aber sicherlich
vom Übel ist.
wesen verschiedener Schattierung in halbgebil‐
deten Kreisen immer noch ist, so sind doch diese
Zirkel ehrlich genug, sich offen als «Spiritisten» zu
bekennen. Wer mit ihnen Fühlung sucht, der ist
entweder schon, auf Grund vorher genossener li‐
terarischer Kost, mehr oder weniger spiritisti‐
scher Gläubigkeit anheimgefallen, oder er will
sich unvoreingenommen orientieren.
Bedenklicher, ‒ weit bedenklicher steht es um
jene neueren Kreise unserer Gesellschaft, die
heimlich Spiritismus treiben und es nicht wahr ha‐
ben wollen, daß dieses Tun nichts anderes ist,
auch wenn man ihm andere Namen gibt.
.Viele darunter glauben sich allen Ernstes be‐
rechtigt, sehr verächtlich auf die deklarierten
«Spiritisten» herabzusehen, wollen vom Spiritis‐
mus durchaus nichts wissen, glauben alles, was sie
erfahren, nur einer «hohen psychischen Entwick‐
lung» danken zu dürfen, und ahnen nicht, daß
das, was ihnen widerfährt, die allerverbreitetste
Abart des «Mediumismus» ist, allen Spiritisten
wohlbekannt und von den Erfahreneren nur in
ganz besonderen Ausnahmefällen den «beweis‐
kräftigen» Phänomenen zugezählt.
.Tatsächlich ist, wie selbst jeder anfängerhafte
Spiritist und wie die ernstere spiritistische Litera‐
Zirkel ehrlich genug, sich offen als «Spiritisten» zu
bekennen. Wer mit ihnen Fühlung sucht, der ist
entweder schon, auf Grund vorher genossener li‐
terarischer Kost, mehr oder weniger spiritisti‐
scher Gläubigkeit anheimgefallen, oder er will
sich unvoreingenommen orientieren.
jene neueren Kreise unserer Gesellschaft, die
heimlich Spiritismus treiben und es nicht wahr ha‐
ben wollen, daß dieses Tun nichts anderes ist,
auch wenn man ihm andere Namen gibt.
rechtigt, sehr verächtlich auf die deklarierten
«Spiritisten» herabzusehen, wollen vom Spiritis‐
mus durchaus nichts wissen, glauben alles, was sie
erfahren, nur einer «hohen psychischen Entwick‐
lung» danken zu dürfen, und ahnen nicht, daß
das, was ihnen widerfährt, die allerverbreitetste
Abart des «Mediumismus» ist, allen Spiritisten
wohlbekannt und von den Erfahreneren nur in
ganz besonderen Ausnahmefällen den «beweis‐
kräftigen» Phänomenen zugezählt.
Spiritist und wie die ernstere spiritistische Litera‐
tur seit fast einem halben Jahrhundert weiß, der
Erfolg beim sogenannten «Tischrücken», wie
beim automatischen Schreiben, an sich durchaus
kein Beweis für die Mitwirkung unsichtbarer, in‐
telligent geleiteter Kräfte.
.(Für gänzlich Fernstehende sei hier eingeschal‐
tet, daß beim «Tischrücken» mehrere Teilnehmer
um einen Tisch herum sitzen, auf den sie die
Hände legen. Früher oder später gerät der Tisch
in Bewegung, die Tischbeine heben und senken
sich, und die Antwort auf gestellte Fragen wird
nach dem Alphabet, je nach der Anzahl der Auf‐
schläge des Tischbeins auf den Boden, buchsta‐
biert. Beim automatischen Schreiben setzt sich das
«Medium» ‒ die Person, von der die unsichtbare
Intelligenz wirklich oder angeblich Besitz ergreift
‒ entweder allein oder mit andern an einen Tisch,
legt ein Papierstück vor sich, nimmt einen Bleistift
und erwartet in passiver Haltung die unwillkürli‐
che Bewegung seiner Hand, durch die dann nach
und nach Schriftzeichen entstehen, die ohne wei‐
teres gelesen werden können.)
.In beiden Fällen ist es möglich, sehr weitge‐
hende Resultate zu erhalten, bei deren Erlan‐
gung niemand anders beteiligt ist als das «Me‐
dium» selbst bzw. seine Beisitzer, wobei ich hier
keineswegs an Betrug denke. Das «Medium» kann
Erfolg beim sogenannten «Tischrücken», wie
beim automatischen Schreiben, an sich durchaus
kein Beweis für die Mitwirkung unsichtbarer, in‐
telligent geleiteter Kräfte.
tet, daß beim «Tischrücken» mehrere Teilnehmer
um einen Tisch herum sitzen, auf den sie die
Hände legen. Früher oder später gerät der Tisch
in Bewegung, die Tischbeine heben und senken
sich, und die Antwort auf gestellte Fragen wird
nach dem Alphabet, je nach der Anzahl der Auf‐
schläge des Tischbeins auf den Boden, buchsta‐
biert. Beim automatischen Schreiben setzt sich das
«Medium» ‒ die Person, von der die unsichtbare
Intelligenz wirklich oder angeblich Besitz ergreift
‒ entweder allein oder mit andern an einen Tisch,
legt ein Papierstück vor sich, nimmt einen Bleistift
und erwartet in passiver Haltung die unwillkürli‐
che Bewegung seiner Hand, durch die dann nach
und nach Schriftzeichen entstehen, die ohne wei‐
teres gelesen werden können.)
hende Resultate zu erhalten, bei deren Erlan‐
gung niemand anders beteiligt ist als das «Me‐
dium» selbst bzw. seine Beisitzer, wobei ich hier
keineswegs an Betrug denke. Das «Medium» kann
in beiden Fällen in völligem Wachzustand sein,
kann aber auch in sogenannten «Trance»-Zustand
verfallen, eine Art autohypnotischen Schlafes, der
die verschiedensten Stadien aufweist und in sei‐
nen Anfangsstadien noch kaum als solcher er‐
kennbar ist.
.Gewisse fluidische Kräfte des unsichtbaren Tei‐
les der physischen Natur des «Mediums» wie der
Teilnehmer sind nun, ebenso wie die Nerven‐
bahnen, von jeder Willensfessel befreit, für sich al‐
lein imstande, sowohl den Tisch wie noch viel
leichter die Hand zu bewegen, und automatisch
lösen sich sodann aus den im Gehirn gleichwie in
einer Grammophonplatte eingeprägten Runen
der Vorstellungsinhalte die entsprechenden Ant‐
worten auf die gehörten ‒ auch im Trancezustand
gehörten ‒ oder auch nur gedachten Fragen los, oft
überraschend gut angepaßt, dann aber auch wie‐
der orakelhaft dunkel, je nach der allgemeinen
und zeitlichen Disposition des «Mediums».
.Öftere Übung spielt diese automatische, durch
Verstand und Willen nicht mehr kontrollierte Tä‐
tigkeit von Gehirn, Nervenbahnen und durch
beide wirkenden Seelenkräften derart ein, daß
die Erfolge oft verblüffend sind, besonders wenn
durch die erhöhte Aufnahmefähigkeit des «Medi‐
ums» auch noch Gedankenbilder anderer wahrge‐
kann aber auch in sogenannten «Trance»-Zustand
verfallen, eine Art autohypnotischen Schlafes, der
die verschiedensten Stadien aufweist und in sei‐
nen Anfangsstadien noch kaum als solcher er‐
kennbar ist.
les der physischen Natur des «Mediums» wie der
Teilnehmer sind nun, ebenso wie die Nerven‐
bahnen, von jeder Willensfessel befreit, für sich al‐
lein imstande, sowohl den Tisch wie noch viel
leichter die Hand zu bewegen, und automatisch
lösen sich sodann aus den im Gehirn gleichwie in
einer Grammophonplatte eingeprägten Runen
der Vorstellungsinhalte die entsprechenden Ant‐
worten auf die gehörten ‒ auch im Trancezustand
gehörten ‒ oder auch nur gedachten Fragen los, oft
überraschend gut angepaßt, dann aber auch wie‐
der orakelhaft dunkel, je nach der allgemeinen
und zeitlichen Disposition des «Mediums».
Verstand und Willen nicht mehr kontrollierte Tä‐
tigkeit von Gehirn, Nervenbahnen und durch
beide wirkenden Seelenkräften derart ein, daß
die Erfolge oft verblüffend sind, besonders wenn
durch die erhöhte Aufnahmefähigkeit des «Medi‐
ums» auch noch Gedankenbilder anderer wahrge‐
nommen und in seiner Mitteilung verwertet wer‐
den: ein Vorgang, der dem «Medium» selbst nicht
zu Bewußtsein kommt.
.Unsere «Neospiritisten» haben aber von alledem
entweder kaum gehört oder stehen gar den Er‐
fahrungen ausgesprochener «Spiritisten» und
wissenschaftlicher Forscher auf diesem Gebiete
absolut fern.
Ein dunkles Ahnen einer unsichtbaren höheren
Welt, der durch religiöse oder phantastische Lek‐
türe erregte Wunsch nach «geistiger» Führung,
deren man sich meist besonders würdig zu wissen
glaubt, oft auch, genau wie bei wissentlichen «Spi‐
ritisten», die Sehnsucht nach einem Lebenszei‐
chen eines kürzlich Gestorbenen, führen meist
spontan die ersten, mehr oder minder primitiven
Phänomene herbei, in denen der Betroffene stau‐
nend und begeisterungsvoll seine besondere Be‐
gnadung bestätigt wähnt.
.Nun vergeht kaum ein Tag, an dem man nicht
mit dem «geistigen» Führer oder mit dem lieben
Dahingegangenen zu verkehren sucht, was bei
solcher Annahme allerdings sehr begreiflich ist.
Alle wichtigen Entscheidungen werden der Gei‐
sterstimme unterbreitet. Man ist selig, sein Privat‐
den: ein Vorgang, der dem «Medium» selbst nicht
zu Bewußtsein kommt.
entweder kaum gehört oder stehen gar den Er‐
fahrungen ausgesprochener «Spiritisten» und
wissenschaftlicher Forscher auf diesem Gebiete
absolut fern.
Welt, der durch religiöse oder phantastische Lek‐
türe erregte Wunsch nach «geistiger» Führung,
deren man sich meist besonders würdig zu wissen
glaubt, oft auch, genau wie bei wissentlichen «Spi‐
ritisten», die Sehnsucht nach einem Lebenszei‐
chen eines kürzlich Gestorbenen, führen meist
spontan die ersten, mehr oder minder primitiven
Phänomene herbei, in denen der Betroffene stau‐
nend und begeisterungsvoll seine besondere Be‐
gnadung bestätigt wähnt.
mit dem «geistigen» Führer oder mit dem lieben
Dahingegangenen zu verkehren sucht, was bei
solcher Annahme allerdings sehr begreiflich ist.
Alle wichtigen Entscheidungen werden der Gei‐
sterstimme unterbreitet. Man ist selig, sein Privat‐
orakel zu besitzen, und jeder vollgekritzelte Bo‐
gen Papier aus solchen Stunden wird wie ein Hei‐
ligtum verwahrt.
.Sind es wirklich nur die Kräfte des «Mediums»
selbst, die ihm Antwort geben (jeder Mensch ist bis
zu gewissem Grade «mediumistisch» veranlagt,
auch wenn es bei ihm nie zu den abnormen Er‐
scheinungen der ausgesprochenen «Medien» spi‐
ritistischer Zirkel kommt), so könnte man in alle‐
dem nur ein harmloses Tun erblicken, wenn nicht
auch dabei schon schwere Schädigungen sich ein‐
stellten, Schädigungen nervöser und seelischer
Art, und vor allem eine allmähliche Paralysierung
der Willensbildung und des Verantwortungsbewußt‐
seins.
.Schlimmer aber wird die Sache dadurch, daß
tatsächlich jederzeit jene unsichtbaren lemuren‐
haften Wesen des unsichtbaren Teiles der physi‐
schen Welt, die in den Sitzungen der spiritisti‐
schen Zirkel eine so verhängnisvolle, täuschende
Rolle spielen, ganz oder teilweise von dem seiner
Meinung nach so hoch «Begnadeten» Besitz er‐
greifen können.
.Die Existenz dieser Wesenheiten wird trotz al‐
ler wissenschaftlichen Erforschung spiritistischer
Phänomene, wie sie gerade neuerdings von vor‐
gen Papier aus solchen Stunden wird wie ein Hei‐
ligtum verwahrt.
selbst, die ihm Antwort geben (jeder Mensch ist bis
zu gewissem Grade «mediumistisch» veranlagt,
auch wenn es bei ihm nie zu den abnormen Er‐
scheinungen der ausgesprochenen «Medien» spi‐
ritistischer Zirkel kommt), so könnte man in alle‐
dem nur ein harmloses Tun erblicken, wenn nicht
auch dabei schon schwere Schädigungen sich ein‐
stellten, Schädigungen nervöser und seelischer
Art, und vor allem eine allmähliche Paralysierung
der Willensbildung und des Verantwortungsbewußt‐
seins.
tatsächlich jederzeit jene unsichtbaren lemuren‐
haften Wesen des unsichtbaren Teiles der physi‐
schen Welt, die in den Sitzungen der spiritisti‐
schen Zirkel eine so verhängnisvolle, täuschende
Rolle spielen, ganz oder teilweise von dem seiner
Meinung nach so hoch «Begnadeten» Besitz er‐
greifen können.
ler wissenschaftlichen Erforschung spiritistischer
Phänomene, wie sie gerade neuerdings von vor‐
urteilsfreien Gelehrten wieder betrieben wird,
niemals einwandfrei und experimentell nach‐
prüfbar zu erweisen sein. Trotzdem scheint dieser
unsichtbare Teil unserer physischen Welt schon in äl‐
testen Zeiten für manche Menschen gelegentlich
seine Pforten geöffnet zu haben, und die Sagen,
Mythen und Märchen, die von «Kobolden», «Na‐
turgeistern» und ähnlichen Unsichtbaren zu be‐
richten wissen, dürften ursprünglich in recht rea‐
ler Erfahrung wurzeln.
.Auch ich vermag keinerlei «Beweise» für das
Dasein unsichtbarer, intelligenter Bewohner un‐
serer physischen Welt zu erbringen, aber ich darf
bekennen, daß es auch heute Menschen auf die‐
sem Planeten gibt, denen dieses unsichtbare
Reich der physischen Welt durch eigene geistige
Anschauung sehr genau bekannt ist, und daß ich
hier aus Erfahrung rede.
.Eben diese Erfahrung ist auch Ursache der er‐
schreckenden Einblicke in seelische Verwüstun‐
gen, die mir die Betroffenen selbst in überaus
zahlreichen Fällen ermöglichten, wobei stets das
Wirken jener unsichtbaren Lemurenwesen fest‐
zustellen war und, wahrhaftig zum Heile der also
Mißbrauchten, in genügend überzeugender
Weise bestätigt werden konnte.
niemals einwandfrei und experimentell nach‐
prüfbar zu erweisen sein. Trotzdem scheint dieser
unsichtbare Teil unserer physischen Welt schon in äl‐
testen Zeiten für manche Menschen gelegentlich
seine Pforten geöffnet zu haben, und die Sagen,
Mythen und Märchen, die von «Kobolden», «Na‐
turgeistern» und ähnlichen Unsichtbaren zu be‐
richten wissen, dürften ursprünglich in recht rea‐
ler Erfahrung wurzeln.
Dasein unsichtbarer, intelligenter Bewohner un‐
serer physischen Welt zu erbringen, aber ich darf
bekennen, daß es auch heute Menschen auf die‐
sem Planeten gibt, denen dieses unsichtbare
Reich der physischen Welt durch eigene geistige
Anschauung sehr genau bekannt ist, und daß ich
hier aus Erfahrung rede.
schreckenden Einblicke in seelische Verwüstun‐
gen, die mir die Betroffenen selbst in überaus
zahlreichen Fällen ermöglichten, wobei stets das
Wirken jener unsichtbaren Lemurenwesen fest‐
zustellen war und, wahrhaftig zum Heile der also
Mißbrauchten, in genügend überzeugender
Weise bestätigt werden konnte.
.Die Wesenheiten, um die es sich hier handelt,
sind weder als «gut» noch als «böse» anzuspre‐
chen. Erfüllt von einer ungebundenen Täu‐
schungslust, kennen sie keinen anderen Drang, als
dem Menschen sich bemerkbar zu machen, was
aber nur unter besonderen Bedingungen mög‐
lich ist, und dann ihn zu beherrschen und sich
selbst den Grad ihrer Herrschaft über ihn zu de‐
monstrieren.
.Ich mag hier nicht alles wiederholen, was ich an
anderer Stelle (in meinem «Buch vom Jenseits»
und anderen Schriften) in ausführlicher Weise
darlegte, möchte vielmehr hier nur betonen, daß
die gewollte oder ungewollte Verbindung mit die‐
sen Wesen die verhängnisvollsten Folgen nach sich
ziehen kann und in allen Fällen dem Menschen
nur Täuschung bringt, dort wo er Klarheit zu erhal‐
ten hoffte.
.Es kann nicht genug vor diesen Regionen ge‐
warnt werden, vor denen die Natur selbst ihre
Schutzwälle weise für den Menschen aufgerichtet
hat.
.Wer wirklich die göttliche Stimme in sich ver‐
nehmen will, der muß andere Wege gehen, und
diese Wege habe ich gezeigt. (Siehe mein «Buch
vom lebendigen Gott».)
sind weder als «gut» noch als «böse» anzuspre‐
chen. Erfüllt von einer ungebundenen Täu‐
schungslust, kennen sie keinen anderen Drang, als
dem Menschen sich bemerkbar zu machen, was
aber nur unter besonderen Bedingungen mög‐
lich ist, und dann ihn zu beherrschen und sich
selbst den Grad ihrer Herrschaft über ihn zu de‐
monstrieren.
anderer Stelle (in meinem «Buch vom Jenseits»
und anderen Schriften) in ausführlicher Weise
darlegte, möchte vielmehr hier nur betonen, daß
die gewollte oder ungewollte Verbindung mit die‐
sen Wesen die verhängnisvollsten Folgen nach sich
ziehen kann und in allen Fällen dem Menschen
nur Täuschung bringt, dort wo er Klarheit zu erhal‐
ten hoffte.
warnt werden, vor denen die Natur selbst ihre
Schutzwälle weise für den Menschen aufgerichtet
hat.
nehmen will, der muß andere Wege gehen, und
diese Wege habe ich gezeigt. (Siehe mein «Buch
vom lebendigen Gott».)
.«Geistige» Leitung, soll sie wirklich diesen Na‐
men verdienen, kann dem Menschen nur in seinem
Allerinnersten werden. Sie bedarf weder des klop‐
fenden Tisches noch der schreibenden Hand. Vor
allem aber wird sie stets den Suchenden selber zum
Finden führen, wird nie ein Gängelband um ihn
schlingen, dem er gleich einem Hypnotisierten
folgen zu müssen glaubt!
.Wer aber die tief verstehbare Sehnsucht fühlt,
mit dem geistig Ewigen derer in Verbindung zu
bleiben, die ihm vorangegangen sind in jenes
stille Reich des Geistes, aus dem kein Zeuge je‐
mals wiederkehrt, der lasse sich durch Gaukel‐
spiel nicht täuschen, auch wenn die unsichtbaren
Gaukler in der Maske jener Heimgekehrten ihm
erscheinen sollten!
.Auch ihm ist kein anderer Weg zu jenen ihm Ent‐
rückten frei, als der Pfad in die leuchtenden
Lande seines allerinnersten geistigen Innern.
.Nur dort allein darf er hoffen, von denen Kunde
zu erhalten, die selbst nur noch in ihrem allerinner‐
sten geistigen Sein von ihm wissen...
men verdienen, kann dem Menschen nur in seinem
Allerinnersten werden. Sie bedarf weder des klop‐
fenden Tisches noch der schreibenden Hand. Vor
allem aber wird sie stets den Suchenden selber zum
Finden führen, wird nie ein Gängelband um ihn
schlingen, dem er gleich einem Hypnotisierten
folgen zu müssen glaubt!
mit dem geistig Ewigen derer in Verbindung zu
bleiben, die ihm vorangegangen sind in jenes
stille Reich des Geistes, aus dem kein Zeuge je‐
mals wiederkehrt, der lasse sich durch Gaukel‐
spiel nicht täuschen, auch wenn die unsichtbaren
Gaukler in der Maske jener Heimgekehrten ihm
erscheinen sollten!
rückten frei, als der Pfad in die leuchtenden
Lande seines allerinnersten geistigen Innern.
zu erhalten, die selbst nur noch in ihrem allerinner‐
sten geistigen Sein von ihm wissen...
Die uns verlassen mußten,
.sind uns nicht verloren:
Sie wurden nur zu einem neuen Leben
.neu geboren.
Wir finden sie dereinst,
.so wie wir hier sie fanden;
Ihr «Tod» war nur die Lösung
.aus des Leibes Banden.
Das enge Haus der Sinne
.faßt «den Menschen» nicht:
Er ist ein König ‒
.und sein Reich ist Licht!
.sind uns nicht verloren:
Sie wurden nur zu einem neuen Leben
.neu geboren.
Wir finden sie dereinst,
.so wie wir hier sie fanden;
Ihr «Tod» war nur die Lösung
.aus des Leibes Banden.
Das enge Haus der Sinne
.faßt «den Menschen» nicht:
Er ist ein König ‒
.und sein Reich ist Licht!
.Hier soll von einem Buche gesprochen werden,
das vielleicht viele Leser der «Magischen Blätter»
noch nicht kennen dürften.
.Der Untertitel des Buches lautet: «Vom gehei‐
men Leben der Seele und der Überwindung des
Todes». Sein Verfasser ist ein tiefschürfender, stil‐
ler Gelehrter, der in einer abgelegenen Ge‐
meinde Thüringens ein anstrengendes Seelsor‐
geamt verwaltet, aber hoch über jeder dogmati‐
schen Gebundenheit steht und mit dem vorur‐
teilsfreien Forschermut des unvoreingenomme‐
nen Wahrheitssuchers an die Aufgaben heran‐
trat, die ihm die Abfassung dieses überaus gründ‐
lichen und bedeutenden Buches stellte.
.Jahrzehntelanges Forschen und sorgfältigstes
Beobachten fanden in seinem Werke ihren Nie‐
derschlag. Nichts was jemals alle Zeiten und Völ‐
ker zur Lösung des Unsterblichkeitsproblems bei‐
zutragen hatten, blieb dem Verfasser fremd, aber
darüber hinaus scheute er auch keine Mühe,
das vielleicht viele Leser der «Magischen Blätter»
noch nicht kennen dürften.
men Leben der Seele und der Überwindung des
Todes». Sein Verfasser ist ein tiefschürfender, stil‐
ler Gelehrter, der in einer abgelegenen Ge‐
meinde Thüringens ein anstrengendes Seelsor‐
geamt verwaltet, aber hoch über jeder dogmati‐
schen Gebundenheit steht und mit dem vorur‐
teilsfreien Forschermut des unvoreingenomme‐
nen Wahrheitssuchers an die Aufgaben heran‐
trat, die ihm die Abfassung dieses überaus gründ‐
lichen und bedeutenden Buches stellte.
Beobachten fanden in seinem Werke ihren Nie‐
derschlag. Nichts was jemals alle Zeiten und Völ‐
ker zur Lösung des Unsterblichkeitsproblems bei‐
zutragen hatten, blieb dem Verfasser fremd, aber
darüber hinaus scheute er auch keine Mühe,
nicht weite Reisen und umfangreiche Korrespon‐
denzen, um dem persönlich näher zu gelangen,
was er mit Recht für die einwandfreieste Basis je‐
der wissenschaftlichen Untersuchung der Un‐
sterblichkeitsfrage hielt: ‒ dem Erlebnis. ‒
.So wurde sein Buch nicht nur zu einem auf‐
schlußreichen Handbuch für alle, die sich für
diese Frage interessieren, sondern, weit darüber
hinaus, zu einem durchaus persönlichen Werk ei‐
nes reifen Denkers.
.In leicht lesbarer, formvollendeter, oft dichte‐
risch verklärter Sprache, bleibt es trotz seiner wis‐
senschaftlichen Gründlichkeit auch dem völligen
Laien durchaus verständlich, ist auf jeder Seite in‐
teressant und voll Bedeutung, zeigt große Aus‐
blicke und gibt das Resultat der Forscherarbeit
seines Autors in einer so abgeklärten und seelisch
durchfühlten Form, daß ich nicht anstehe zu sa‐
gen: ‒ dieses Buch gehört zum Besten und Schönsten,
was jemals über das gleiche Problem geschrieben wurde!
.Aber es sei gleich hier schon bemerkt, daß ich
mich nicht mit allen Resultaten, zu denen Dr.
Vogl gelangt, einverstanden erklären kann, und
die Kenner meiner Schriften werden unschwer
die Stellen in dem hier empfohlenen Buche fin‐
den, auf die sich meine Einwände beziehen, so
denzen, um dem persönlich näher zu gelangen,
was er mit Recht für die einwandfreieste Basis je‐
der wissenschaftlichen Untersuchung der Un‐
sterblichkeitsfrage hielt: ‒ dem Erlebnis. ‒
schlußreichen Handbuch für alle, die sich für
diese Frage interessieren, sondern, weit darüber
hinaus, zu einem durchaus persönlichen Werk ei‐
nes reifen Denkers.
risch verklärter Sprache, bleibt es trotz seiner wis‐
senschaftlichen Gründlichkeit auch dem völligen
Laien durchaus verständlich, ist auf jeder Seite in‐
teressant und voll Bedeutung, zeigt große Aus‐
blicke und gibt das Resultat der Forscherarbeit
seines Autors in einer so abgeklärten und seelisch
durchfühlten Form, daß ich nicht anstehe zu sa‐
gen: ‒ dieses Buch gehört zum Besten und Schönsten,
was jemals über das gleiche Problem geschrieben wurde!
mich nicht mit allen Resultaten, zu denen Dr.
Vogl gelangt, einverstanden erklären kann, und
die Kenner meiner Schriften werden unschwer
die Stellen in dem hier empfohlenen Buche fin‐
den, auf die sich meine Einwände beziehen, so
daß ich kaum genötigt bin, Seite für Seite darauf
einzugehen.
.Im wesentlichen richtet sich die hier angedeu‐
tete kritische Stellungnahme nur gegen eine ge‐
wisse Weitherzigkeit des Verfassers, die ihn dazu
führt ‒ quasi aus einem Übermaß an Toleranz ‒
okkulte Phänomene sehr verschiedenwertiger Art
dennoch gleichwertig zu behandeln, und überdies
scheint mir die Gefahr zu bestehen, daß hier das
Phänomen oft allzusehr in den Vordergrund tritt,
um so das eigentliche Erlebnis als seelische Reaktion
zurückzudrängen. ‒ ‒
.Daneben habe ich meine Bedenken, wenn Dr.
Vogl das indische Nirvana-Erlebnis, das er zwar
wunderbar klar zu vermitteln sucht, in jener, eu‐
ropäischen Gelehrten und Okkultisten geläufi‐
gen und wohl auch bei einigen indischen Sekten
findbaren Weise ausdeutet, wie es nur auf psycho‐
pathologischer Basis zustandekommt.
.‒ Ich kenne es anders, ‒ und auch bei Rabindra‐
nath Tagore fand ich in diesen Tagen zu meiner
Freude eine dem echten Erfassen weit mehr ent‐
sprechende Erklärung. ‒
.So wunderschön daher auch das Schlußkapitel
des Buches «Unsterblichkeit» ausklingt, so würde
ich doch wünschen, der auf das Nirvana-Erlebnis
einzugehen.
tete kritische Stellungnahme nur gegen eine ge‐
wisse Weitherzigkeit des Verfassers, die ihn dazu
führt ‒ quasi aus einem Übermaß an Toleranz ‒
okkulte Phänomene sehr verschiedenwertiger Art
dennoch gleichwertig zu behandeln, und überdies
scheint mir die Gefahr zu bestehen, daß hier das
Phänomen oft allzusehr in den Vordergrund tritt,
um so das eigentliche Erlebnis als seelische Reaktion
zurückzudrängen. ‒ ‒
Vogl das indische Nirvana-Erlebnis, das er zwar
wunderbar klar zu vermitteln sucht, in jener, eu‐
ropäischen Gelehrten und Okkultisten geläufi‐
gen und wohl auch bei einigen indischen Sekten
findbaren Weise ausdeutet, wie es nur auf psycho‐
pathologischer Basis zustandekommt.
nath Tagore fand ich in diesen Tagen zu meiner
Freude eine dem echten Erfassen weit mehr ent‐
sprechende Erklärung. ‒
des Buches «Unsterblichkeit» ausklingt, so würde
ich doch wünschen, der auf das Nirvana-Erlebnis
bezügliche Passus wäre dort fortgeblieben, zumal
er auch inkonsequent wirkt, denn hier gelangt der
Autor, nachdem er eingangs die Unzulänglichkeit
des Denkens zur Lösung des Unsterblichkeitspro‐
blems so überzeugend darlegt und alles Forschen
auf das Erlebnis gegründet sehen will, unverse‐
hens zur Philosophie, und damit zum Denken zu‐
rück, ‒ wobei ihm freilich zur Rechtfertigung die‐
nen mag, daß er speziell die indische Philosophie
als auf das Erlebnis gegründet auffaßt.
.Ich glaube aber, daß diese meine Einwände, die
ich keinesfalls verschweigen durfte, keinem Ein‐
sichtigen das Buch «Unsterblichkeit» entwerten
können.
.Die ganze Grundtendenz des Buches ist so wert‐
voll und hocherfreulich, die ganze Gesamtgestaltung
des Buches ist so vollendet, daß es wahrhaftig in sei‐
nem inneren Werte völlig intakt bleibt, auch wenn
da und dort eine Schlußfolgerung des Verfassers
so gegeben ist, daß man sie ‒ eben aus eigenem
Erlebnis heraus ‒ und einst belehrt von den beru‐
fensten «Wissenden» auf diesem Gebiet, als irrig
ansprechen muß. ‒ ‒
.Wer dieses Buch richtig zu lesen weiß, dem
kann es eine gesegnete Fülle innerer Aufschlüsse
vermitteln, und manches Wort seines Autors läßt
er auch inkonsequent wirkt, denn hier gelangt der
Autor, nachdem er eingangs die Unzulänglichkeit
des Denkens zur Lösung des Unsterblichkeitspro‐
blems so überzeugend darlegt und alles Forschen
auf das Erlebnis gegründet sehen will, unverse‐
hens zur Philosophie, und damit zum Denken zu‐
rück, ‒ wobei ihm freilich zur Rechtfertigung die‐
nen mag, daß er speziell die indische Philosophie
als auf das Erlebnis gegründet auffaßt.
ich keinesfalls verschweigen durfte, keinem Ein‐
sichtigen das Buch «Unsterblichkeit» entwerten
können.
voll und hocherfreulich, die ganze Gesamtgestaltung
des Buches ist so vollendet, daß es wahrhaftig in sei‐
nem inneren Werte völlig intakt bleibt, auch wenn
da und dort eine Schlußfolgerung des Verfassers
so gegeben ist, daß man sie ‒ eben aus eigenem
Erlebnis heraus ‒ und einst belehrt von den beru‐
fensten «Wissenden» auf diesem Gebiet, als irrig
ansprechen muß. ‒ ‒
kann es eine gesegnete Fülle innerer Aufschlüsse
vermitteln, und manches Wort seines Autors läßt
sich, besonders für Fortgeschrittene, in einer
Weise deuten, die ihm eine vielleicht von dem Au‐
tor selbst noch kaum ganz erfaßte Tragweite
gibt...
.Ich bin sicher, daß dieser Gelehrte auch keines‐
wegs bei seinen ersten Ergebnissen stehen bleiben
wird, ja ich habe begründete Anzeichen dafür,
daß er wohl schon heute zu Ergebnissen gelangte,
die es ihm durchaus erwünscht erscheinen lassen,
daß ich neben aller vorbehaltslosen Würdigung
seines Werkes doch auch nicht verschwiegen
habe, was mir aus meiner eigenen Einsicht heraus
noch der Nachprüfung bedürftig erscheint.
.Wer dieses Buch schreiben konnte, hat allen
Anspruch auf die eindringlichste Beachtung aller, die
sich mit den magischen Tatsachen des Seelenle‐
bens befassen, umsomehr als die okkultistische Li‐
teratur nur sehr wenige Werke aufweist, die auch
nur von ferne der Bedeutung dieses Buches
gleichkommen! Dr. Vogl darf als ein Pfadfinder auf
den Gebieten des Übersinnlichen bezeichnet werden,
dessen Fußspuren zu folgen, jedem ernsthaften
Suchenden empfohlen werden muß. ‒
.Außer dem fesselnden Inhalt des Buches «Un‐
sterblichkeit» werden auch die im «Anhang» zusam‐
Weise deuten, die ihm eine vielleicht von dem Au‐
tor selbst noch kaum ganz erfaßte Tragweite
gibt...
wegs bei seinen ersten Ergebnissen stehen bleiben
wird, ja ich habe begründete Anzeichen dafür,
daß er wohl schon heute zu Ergebnissen gelangte,
die es ihm durchaus erwünscht erscheinen lassen,
daß ich neben aller vorbehaltslosen Würdigung
seines Werkes doch auch nicht verschwiegen
habe, was mir aus meiner eigenen Einsicht heraus
noch der Nachprüfung bedürftig erscheint.
Anspruch auf die eindringlichste Beachtung aller, die
sich mit den magischen Tatsachen des Seelenle‐
bens befassen, umsomehr als die okkultistische Li‐
teratur nur sehr wenige Werke aufweist, die auch
nur von ferne der Bedeutung dieses Buches
gleichkommen! Dr. Vogl darf als ein Pfadfinder auf
den Gebieten des Übersinnlichen bezeichnet werden,
dessen Fußspuren zu folgen, jedem ernsthaften
Suchenden empfohlen werden muß. ‒
sterblichkeit» werden auch die im «Anhang» zusam‐
mengefaßten «Anmerkungen» und «Literatur‐
nachweise» hochwillkommen sein.
.Was da mit wissenschaftlicher Gründlichkeit
zusammengetragen wurde, ist schon für sich allein
betrachtet: wertvollstes Material, das zum Teil weit
über die eigentlichen Ergebnisse des Buches
selbst hinausweist.
.Auf diese Art betrachtet, stellt sich das wegwei‐
sende und bedeutende Werk als ein Führer in die
Grenzlande des Übersinnlichen dar, und ich erblicke
das Wertvollste des ganzen Buches in dem, was
der Autor selbst zu sagen hat, aus eigenem Erle‐
ben, so daß ich all seinen, auf hoher Gelehrsam‐
keit beruhenden, philosophischen und mehr nur
spekulativ gearteten Expektorationen doch nur se‐
kundäre Bedeutung beilege, im Hinblick auf die
Bekundung des reichen und abgeklärten Geistes, die
uns aus dem Ganzen des Werkes entgegenstrahlt.
.In unserer Zeit, in der jeder geschickte Be‐
griffsjongleur sich berufen glaubt, die Welt mit
seinen Eintagserzeugnissen zu überschwemmen,
mit wissenschaftlich übertünchten Machwerken,
die nichts anders sind, als ein Aufguß aus schon
hundertmal gehörten okkultistischen Theore‐
men, ist es besonders dankbar zu begrüßen, wenn
ein wahrhaft Berufener erscheint. Als solchen aber
nachweise» hochwillkommen sein.
zusammengetragen wurde, ist schon für sich allein
betrachtet: wertvollstes Material, das zum Teil weit
über die eigentlichen Ergebnisse des Buches
selbst hinausweist.
sende und bedeutende Werk als ein Führer in die
Grenzlande des Übersinnlichen dar, und ich erblicke
das Wertvollste des ganzen Buches in dem, was
der Autor selbst zu sagen hat, aus eigenem Erle‐
ben, so daß ich all seinen, auf hoher Gelehrsam‐
keit beruhenden, philosophischen und mehr nur
spekulativ gearteten Expektorationen doch nur se‐
kundäre Bedeutung beilege, im Hinblick auf die
Bekundung des reichen und abgeklärten Geistes, die
uns aus dem Ganzen des Werkes entgegenstrahlt.
griffsjongleur sich berufen glaubt, die Welt mit
seinen Eintagserzeugnissen zu überschwemmen,
mit wissenschaftlich übertünchten Machwerken,
die nichts anders sind, als ein Aufguß aus schon
hundertmal gehörten okkultistischen Theore‐
men, ist es besonders dankbar zu begrüßen, wenn
ein wahrhaft Berufener erscheint. Als solchen aber
begrüße ich den Verfasser des Buches «Unsterblichkeit»,
und ich bin über allen Zweifel sicher, daß sein
Buch jedem Leser, auf welcher Stufe des Erken‐
nens er auch angelangt sein mag, reichen Gewinn
bringen wird. ‒
und ich bin über allen Zweifel sicher, daß sein
Buch jedem Leser, auf welcher Stufe des Erken‐
nens er auch angelangt sein mag, reichen Gewinn
bringen wird. ‒
.Trotzdem in dem Geleitwort des einen der drei
Übersetzer meines Namens als eines Gliedes der
Hierarchie des Geistes, in außerordentlicher
Weise gedacht wird, trotzdem die Einsichten der
Übersetzer sie unschwer als Schüler der Lehren
ausweisen, die ich in meinen Tagen den Men‐
schen meiner Zeit geben durfte, sehe ich mich
verpflichtet, mit Wärme für dieses mir eben über‐
sandte Büchlein einzutreten...
.Es wäre eine falsche «Bescheidenheit», eine Be‐
scheidenheit, die der Lüge nur allzu nahe käme,
wollte ich nicht auch meinerseits bestätigen, daß
die Übersetzer dieser kleinen Berichte völlig ihre
Tragweite erkannten, daß sie auch in dem, was sie
Übersetzer meines Namens als eines Gliedes der
Hierarchie des Geistes, in außerordentlicher
Weise gedacht wird, trotzdem die Einsichten der
Übersetzer sie unschwer als Schüler der Lehren
ausweisen, die ich in meinen Tagen den Men‐
schen meiner Zeit geben durfte, sehe ich mich
verpflichtet, mit Wärme für dieses mir eben über‐
sandte Büchlein einzutreten...
scheidenheit, die der Lüge nur allzu nahe käme,
wollte ich nicht auch meinerseits bestätigen, daß
die Übersetzer dieser kleinen Berichte völlig ihre
Tragweite erkannten, daß sie auch in dem, was sie
* Bei den «Meister in Indien» handelt es sich nicht um 00
Leuchtende im Sinne von Bô Yin Râ, sondern um den zu 00
jener Zeit bekannt gewordenen Ramana Mahârshi und 00
dessen Chela Sastriar.
** Aus dem Englischen ins Deutsche übertragen von Paul 00
Behnke, Alfred Müller und Edgar Treusein.
Leuchtende im Sinne von Bô Yin Râ, sondern um den zu 00
jener Zeit bekannt gewordenen Ramana Mahârshi und 00
dessen Chela Sastriar.
** Aus dem Englischen ins Deutsche übertragen von Paul 00
Behnke, Alfred Müller und Edgar Treusein.
erläuternd hinzufügen zu müssen glaubten, mit
größter Sorgfalt bemüht waren, sichersten Boden zu
gewinnen, und daß so diese kleine Schrift eine Be‐
deutung erlangte, die sie hoch emporhebt über
gar manches dickleibige Buch, in dem nach Art
der Lederstrumpf- und Robinsongeschichten von
denen gesprochen wird, deren geistigem Kreise
ich zugehöre, nicht durch eigenes «Verdienst»,
oder als «Belohnung» meines Strebens, sondern
weil sie mich selbst zu einem der ihren, und für
die mir von ihnen gestellte schwere Aufgabe in
sorglichster Weise bereiteten, wie sie auch jene,
für einen kleineren Wirkungskreis Verpflichteten
bereitet haben, von denen die vorliegenden Be‐
richte eines offenbar sehr einfachen Mannes in
ungekünstelter Weise erzählen.
.Schon der Umstand, daß hier, wo gewiß die
sprachliche Übersetzung an sich keine Schwierig‐
keiten bot, doch keiner der Übersetzer allein die
Verantwortung auf sich nehmen wollte, ergibt ei‐
nen Beweis dafür, wie sehr die drei Männer, die
dieses Büchlein in deutscher Sprache vorlegen,
sich bewußt waren, welche Wichtigkeit den Be‐
richten zugesprochen werden muß, die tatsäch‐
lich von einem auch von mir in Freundschaft ver‐
ehrten Wissenden weit höher geschätzt werden,
als fast alle, sonst so schwer zugänglichen okkulti‐
größter Sorgfalt bemüht waren, sichersten Boden zu
gewinnen, und daß so diese kleine Schrift eine Be‐
deutung erlangte, die sie hoch emporhebt über
gar manches dickleibige Buch, in dem nach Art
der Lederstrumpf- und Robinsongeschichten von
denen gesprochen wird, deren geistigem Kreise
ich zugehöre, nicht durch eigenes «Verdienst»,
oder als «Belohnung» meines Strebens, sondern
weil sie mich selbst zu einem der ihren, und für
die mir von ihnen gestellte schwere Aufgabe in
sorglichster Weise bereiteten, wie sie auch jene,
für einen kleineren Wirkungskreis Verpflichteten
bereitet haben, von denen die vorliegenden Be‐
richte eines offenbar sehr einfachen Mannes in
ungekünstelter Weise erzählen.
sprachliche Übersetzung an sich keine Schwierig‐
keiten bot, doch keiner der Übersetzer allein die
Verantwortung auf sich nehmen wollte, ergibt ei‐
nen Beweis dafür, wie sehr die drei Männer, die
dieses Büchlein in deutscher Sprache vorlegen,
sich bewußt waren, welche Wichtigkeit den Be‐
richten zugesprochen werden muß, die tatsäch‐
lich von einem auch von mir in Freundschaft ver‐
ehrten Wissenden weit höher geschätzt werden,
als fast alle, sonst so schwer zugänglichen okkulti‐
stischen Werke seiner wahrlich erlesenen und rei‐
chen Bibliothek. ‒
.Mir ist vor allem maßgebend, daß in diesem
kleinen Schriftchen jedes Wort, das die eigentli‐
che Lehre betrifft, auf Wahrheit beruht, daß die all‐
gemeine Charakterisierung der beiden «Meister» ‒
vielleicht abgesehen von einigen wenigen und
nicht ins Gewicht fallenden mythologisierenden
Zügen ‒ tatsächlich die menschliche Wesensart
wirklicher «Meister» getreu widerspiegelt, und daß so
der Suchende endlich befreit wird von den myste‐
riösen, theatermäßigen Vorstellungen, denen er
in fast allen anderweitigen Berichten über angeb‐
liche Mahâtmas zu erliegen droht, wenn er sich
nicht in gesundem Ekel vor derlei Mummen‐
schanz abwendet und dabei dann allerdings auch
das Körnchen Wahrheit, das hinter allen diesen my‐
stifizierenden Erzählungen dennoch gesucht zu
werden verdiente, völlig aus den Augen verliert. ‒
.Ich kann daher das Büchlein «Meister in Indien»
nur jedem Suchenden ohne Vorbehalt empfehlen
und den von heiliger Ehrfurcht vor der Wahrheit
erfüllten, bereits sehr «wissenden» Übersetzern
Dank sagen, daß sie auf ihre Weise mithelfen, an
Stelle verwirrender und phantastisch ausge‐
schmückter Sagen, einfache Tatsachen zu setzen,
die allerdings weit weniger seltsam klingen als der
chen Bibliothek. ‒
kleinen Schriftchen jedes Wort, das die eigentli‐
che Lehre betrifft, auf Wahrheit beruht, daß die all‐
gemeine Charakterisierung der beiden «Meister» ‒
vielleicht abgesehen von einigen wenigen und
nicht ins Gewicht fallenden mythologisierenden
Zügen ‒ tatsächlich die menschliche Wesensart
wirklicher «Meister» getreu widerspiegelt, und daß so
der Suchende endlich befreit wird von den myste‐
riösen, theatermäßigen Vorstellungen, denen er
in fast allen anderweitigen Berichten über angeb‐
liche Mahâtmas zu erliegen droht, wenn er sich
nicht in gesundem Ekel vor derlei Mummen‐
schanz abwendet und dabei dann allerdings auch
das Körnchen Wahrheit, das hinter allen diesen my‐
stifizierenden Erzählungen dennoch gesucht zu
werden verdiente, völlig aus den Augen verliert. ‒
nur jedem Suchenden ohne Vorbehalt empfehlen
und den von heiliger Ehrfurcht vor der Wahrheit
erfüllten, bereits sehr «wissenden» Übersetzern
Dank sagen, daß sie auf ihre Weise mithelfen, an
Stelle verwirrender und phantastisch ausge‐
schmückter Sagen, einfache Tatsachen zu setzen,
die allerdings weit weniger seltsam klingen als der
bisher meist verbreitete, auf üppig gedüngter
Erde erwachsene mediumistische «Meister»‐
Spuk, dafür aber Wirklichkeit sprechen lassen, wo
bisher Traumwahn orakelte. ‒ ‒
.Die Ausstattung der kleinen Schrift ist äußerst
vornehm und die beiden, in vorzüglicher Repro‐
duktion wiedergegebenen Photographien des
«Meisters» Sastriar und des Mahârshi, seines höhe‐
ren «Bruders», dürften jedem natürlichen, feine‐
ren Empfinden manches zu sagen haben, beson‐
ders im Vergleich zu gewissen angeblichen «Mei‐
sterbildern», die noch unglaublicherweise in so
manchen okkultistischen, bzw. theosophischen
Kreisen Verehrung genießen, obwohl wahrlich
nicht allzuviel Kritikfähigkeit dazu gehören
dürfte, diese letztgenannten Phantome einer
überreizten Phantasie, die noch dazu in einer
künstlerisch so unmöglichen Art gestaltet wur‐
den, als das zu erkennen, was sie wirklich sind...
.Ich hoffe und wünsche, daß die vorliegenden
Berichte manches nur erträumte Ideal endgültig in
sein leeres Nichts zurückweisen werden, um an
dessen Stelle würdigeren Vorstellungen in bezug
auf jene Geisteseinheit Platz zu schaffen, die tat‐
sächlich von Menschen dieser Erde verkörpert wird,
um Licht zu verbreiten, wo ohne sie nur der finster‐
ste Aberglaube herrschen würde. ‒ ‒ ‒
Erde erwachsene mediumistische «Meister»‐
Spuk, dafür aber Wirklichkeit sprechen lassen, wo
bisher Traumwahn orakelte. ‒ ‒
vornehm und die beiden, in vorzüglicher Repro‐
duktion wiedergegebenen Photographien des
«Meisters» Sastriar und des Mahârshi, seines höhe‐
ren «Bruders», dürften jedem natürlichen, feine‐
ren Empfinden manches zu sagen haben, beson‐
ders im Vergleich zu gewissen angeblichen «Mei‐
sterbildern», die noch unglaublicherweise in so
manchen okkultistischen, bzw. theosophischen
Kreisen Verehrung genießen, obwohl wahrlich
nicht allzuviel Kritikfähigkeit dazu gehören
dürfte, diese letztgenannten Phantome einer
überreizten Phantasie, die noch dazu in einer
künstlerisch so unmöglichen Art gestaltet wur‐
den, als das zu erkennen, was sie wirklich sind...
Berichte manches nur erträumte Ideal endgültig in
sein leeres Nichts zurückweisen werden, um an
dessen Stelle würdigeren Vorstellungen in bezug
auf jene Geisteseinheit Platz zu schaffen, die tat‐
sächlich von Menschen dieser Erde verkörpert wird,
um Licht zu verbreiten, wo ohne sie nur der finster‐
ste Aberglaube herrschen würde. ‒ ‒ ‒
Zum empfohlenen Buch (nicht i.d. Nachlese enthalten)
.Nachdem man geraume Zeit in deutschen Lan‐
den einer gewissen Scheu vor jedem Gedichtband
begegnet war, bewegt sich heute unstreitig das In‐
teresse am Gedicht als solchem wieder in aufstei‐
gender Linie. Man empfindet wieder den seelen‐
lösenden Himmelstau, der aus wirklich guter Ly‐
rik, wie aus keiner anderen Form dichterischen
Schaffens sich über die eigene Stimmung hernie‐
dersenkt, weiß wieder jene subtilen Empfindun‐
gen zu schätzen, die Reim und Rhythmus der
Sprache entlocken können, kurz: man liest wie‐
der Gedichte!
.Nun ist aber in unserer Zeit, in der jeder dritte
Mensch mit leidlichem Geschmack oder grausa‐
mem Ungeschmack sich zum Reimen berufen
fühlt, der Kunstform des Gedichtes arge Unbill
widerfahren und widerfährt ihr noch Tag für Tag.
.Die alte Gartenlaubenlyrik gräßlichen Ange‐
denkens pudert und frisiert sich dem Zeitge‐
schmack entsprechend und gilt als «neue Dich‐
den einer gewissen Scheu vor jedem Gedichtband
begegnet war, bewegt sich heute unstreitig das In‐
teresse am Gedicht als solchem wieder in aufstei‐
gender Linie. Man empfindet wieder den seelen‐
lösenden Himmelstau, der aus wirklich guter Ly‐
rik, wie aus keiner anderen Form dichterischen
Schaffens sich über die eigene Stimmung hernie‐
dersenkt, weiß wieder jene subtilen Empfindun‐
gen zu schätzen, die Reim und Rhythmus der
Sprache entlocken können, kurz: man liest wie‐
der Gedichte!
Mensch mit leidlichem Geschmack oder grausa‐
mem Ungeschmack sich zum Reimen berufen
fühlt, der Kunstform des Gedichtes arge Unbill
widerfahren und widerfährt ihr noch Tag für Tag.
denkens pudert und frisiert sich dem Zeitge‐
schmack entsprechend und gilt als «neue Dich‐
tung», während auf der anderen Seite barbari‐
sche Sprachverstümmelung eine seltsame Clow‐
nerie ihre geschmacklosen Kapriolen schlagen
läßt.
.Einsam steht ferne all diesem betulich-beflisse‐
nen Gebahren der wirkliche Dichter, und gute Ly‐
rik, die, aus klingender Seele geboren, der Mut‐
tersprache Laute in Musik zu wandeln weiß, ist
seltener geworden als je. ‒
.In solchen Tagen ist es geradezu ein Labsal, ei‐
nem Gedichtbande zu begegnen wie dem vorlie‐
genden.
.Es sind durchweg nur kleinere Gedichte. Auf
dem Titelblatt des schmalen, auch in seinem Äus‐
seren überaus vornehm, still und edel wirkenden
Bandes steht, gleichsam als Vorzeichen der Ton‐
art, das Goethewort: ‒
.«Jeden Nachklang fühlt mein Herz froh- und
trüber Zeit,
.Wandle zwischen Freud' und Schmerz in der
Einsamkeit.»
.Und so wie hier über dem Tor des Gartens die‐
ser reifen, starken Dichterin ein Wort des von ihr
ehrfurchtdurchdrungen erfühlten Größten steht,
sche Sprachverstümmelung eine seltsame Clow‐
nerie ihre geschmacklosen Kapriolen schlagen
läßt.
nen Gebahren der wirkliche Dichter, und gute Ly‐
rik, die, aus klingender Seele geboren, der Mut‐
tersprache Laute in Musik zu wandeln weiß, ist
seltener geworden als je. ‒
nem Gedichtbande zu begegnen wie dem vorlie‐
genden.
dem Titelblatt des schmalen, auch in seinem Äus‐
seren überaus vornehm, still und edel wirkenden
Bandes steht, gleichsam als Vorzeichen der Ton‐
art, das Goethewort: ‒
trüber Zeit,
.Wandle zwischen Freud' und Schmerz in der
Einsamkeit.»
ser reifen, starken Dichterin ein Wort des von ihr
ehrfurchtdurchdrungen erfühlten Größten steht,
so gibt sie auch jedem Blumenbeete ihres Gartens
eine Inschrifttafel mit Versen Goethes.
.Vielleicht kein ganz ungefährliches Unterfan‐
gen? ‒ Aber wer diese reine, quellende Lyrik in
sich trägt wie Erika von Watzdorf-Bachoff, der darf
schon ruhig bewußt große Vergleiche wecken, die
manchem anderen recht fatal werden könnten. ‒
.«Heimat», «Einsamkeit und Erinnerung»,
«Weimar» und «Sternenfreundschaft» sind die
vier Teile des Gedichtbandes überschrieben. Der
Titel des Ganzen: «Nachklang», weist von selbst auf
das lange vorher schon Erschienene zurück. Wem
das Schaffen der Dichterin, die Johannes Schlaf
wahrhaftig nicht zu Unrecht nur der Droste-Hüls‐
hoff an die Seite stellen zu dürfen glaubt, nicht oh‐
nehin bekannt ist, dem seien hier ihre früheren
Bände genannt: das stattliche Bändchen «Zwi‐
schen Frühling und Herbst», das bei Cotta erschien,
sowie «Das Jahr und neue Gedichte», 1913 bei Kiepen‐
heuer erschienen. Dazu kommt noch der feinsin‐
nige, im Milieu ihrer Jugend spielende Roman
«Maria und Yvonne», der ebenfalls bei Cotta verlegt
wurde.
.Es ist nicht die Aufgabe des Rezensenten eines
Gedichtbandes, die einzelnen Gedichte irgend‐
wie inhaltlich zu erläutern. Auch würde es mir
eine Inschrifttafel mit Versen Goethes.
gen? ‒ Aber wer diese reine, quellende Lyrik in
sich trägt wie Erika von Watzdorf-Bachoff, der darf
schon ruhig bewußt große Vergleiche wecken, die
manchem anderen recht fatal werden könnten. ‒
«Weimar» und «Sternenfreundschaft» sind die
vier Teile des Gedichtbandes überschrieben. Der
Titel des Ganzen: «Nachklang», weist von selbst auf
das lange vorher schon Erschienene zurück. Wem
das Schaffen der Dichterin, die Johannes Schlaf
wahrhaftig nicht zu Unrecht nur der Droste-Hüls‐
hoff an die Seite stellen zu dürfen glaubt, nicht oh‐
nehin bekannt ist, dem seien hier ihre früheren
Bände genannt: das stattliche Bändchen «Zwi‐
schen Frühling und Herbst», das bei Cotta erschien,
sowie «Das Jahr und neue Gedichte», 1913 bei Kiepen‐
heuer erschienen. Dazu kommt noch der feinsin‐
nige, im Milieu ihrer Jugend spielende Roman
«Maria und Yvonne», der ebenfalls bei Cotta verlegt
wurde.
Gedichtbandes, die einzelnen Gedichte irgend‐
wie inhaltlich zu erläutern. Auch würde es mir
verfehlt scheinen, dies oder jenes Gedicht zitieren
zu wollen, denn stets bleibt hier die Wahl viel zu
subjektiv bestimmt, und es besteht die Gefahr, das
Bild der Dichterin zu verzeichnen. Lyrische
Kunst in höchster Vollendung, herbsüße Frauen‐
lyrik voll rhythmischer Schönheit, eine Sprache,
die restlos in Wohllaut und Klang aufgeht, bietet
jede Seite des Bandes! Ich sage mit Vorbedacht:
Frauenlyrik, denn nichts ist hier männlichem Füh‐
len nachempfunden, alles kündet nur von dem
reichen, starken Schwingen und Sehnen einer in
Freud und Leid gleich erlebenstiefen Frauen‐
seele. Erika von Walzdorf-Bachoff gehört zu den
wenigen Erlesenen der heutigen Menschheit, die
in weiser Selbstgestaltung ihr Leben zu formen
wissen, so daß nichts Unedles ihnen zu nahen ver‐
mag. Aus solcher Lebensformung fließt das Werk
der Dichterin. Solcher Selbstdarstellung dankt sie
die unbestreitbare Eigenform ihrer Gedichte.
Wer Vollendetes liebt und Echtes zu beurteilen
weiß, der wird ihre Kunst, die stets nur reifster
Ausdruck innersten Fühlens ist, wahrlich zu
schätzen wissen.
zu wollen, denn stets bleibt hier die Wahl viel zu
subjektiv bestimmt, und es besteht die Gefahr, das
Bild der Dichterin zu verzeichnen. Lyrische
Kunst in höchster Vollendung, herbsüße Frauen‐
lyrik voll rhythmischer Schönheit, eine Sprache,
die restlos in Wohllaut und Klang aufgeht, bietet
jede Seite des Bandes! Ich sage mit Vorbedacht:
Frauenlyrik, denn nichts ist hier männlichem Füh‐
len nachempfunden, alles kündet nur von dem
reichen, starken Schwingen und Sehnen einer in
Freud und Leid gleich erlebenstiefen Frauen‐
seele. Erika von Walzdorf-Bachoff gehört zu den
wenigen Erlesenen der heutigen Menschheit, die
in weiser Selbstgestaltung ihr Leben zu formen
wissen, so daß nichts Unedles ihnen zu nahen ver‐
mag. Aus solcher Lebensformung fließt das Werk
der Dichterin. Solcher Selbstdarstellung dankt sie
die unbestreitbare Eigenform ihrer Gedichte.
Wer Vollendetes liebt und Echtes zu beurteilen
weiß, der wird ihre Kunst, die stets nur reifster
Ausdruck innersten Fühlens ist, wahrlich zu
schätzen wissen.
REZENSION, VIELLEICHT
AUCH SELBSTANZEIGE*
AUCH SELBSTANZEIGE*
ES kam ein Mensch zu mir, der einer meiner
nächsten Schüler werden mußte, weil er es
lange vorher schon im Geistigen war.
.Dieser Mensch wurde mir zum intimsten
Freunde.
.Was Wunder, wenn er als Kunsthistoriker sich
berufen und bewogen fand, ein Buch über meine
Kunst zu schreiben.
.Ich kann dieses Buch nicht hinausgehen lassen,
ohne ihm ein paar Geleitworte mitzugeben.
.Freilich kann ich nur über das Buch selber spre‐
chen, denn es stünde mir übel an, seine Werturteile
zu begutachten.
nächsten Schüler werden mußte, weil er es
lange vorher schon im Geistigen war.
Freunde.
berufen und bewogen fand, ein Buch über meine
Kunst zu schreiben.
ohne ihm ein paar Geleitworte mitzugeben.
chen, denn es stünde mir übel an, seine Werturteile
zu begutachten.
* Bezieht sich auf «Der Maler Bô Yin Râ» von R. Schott, 00
München, Hanfstaengl. 1927. Eine zweite erweiterte 00
Ausgabe erschien 1960 in der Koberschen Verlagsbuch‐ 00
handlung, Bern.
München, Hanfstaengl. 1927. Eine zweite erweiterte 00
Ausgabe erschien 1960 in der Koberschen Verlagsbuch‐ 00
handlung, Bern.
.Was aber das Buch selber betrifft, so kann ich
nur sagen, daß es mit einer Einfühlungssicherheit
und genialen Erfassung des Wesentlichen ge‐
schrieben ist, die für mein eigenes Urteil sicher
ans Wunderbare grenzt.
.Es ist hier unendlich vieles zu Worte geworden,
was mir selbst immer unaussprechlich schien.
.Aber es ist die alte Geschichte: ‒ ohne den An‐
schlag des Stahles springt der Funke nicht aus
dem Feuerstein. ‒ ‒
.Ich sollte Rudolf Schott, der das Buch über den
Maler Bô Yin Râ geschrieben hat, eigentlich recht
«böse» sein, denn er hat mich bis aufs Blut ge‐
quält, um alles das aus mir heraus zu holen, was er
für sein Buch zu brauchen glaubte.
.Allein, das Resultat seiner unermüdlichen Ar‐
beit zwingt mich denn doch, ihm vor aller Öffent‐
lichkeit für die Tortur zu danken, der er mich so
manchen Achtstundentag und manche Nacht‐
stunde hindurch mit unerbittlicher Grausamkeit
unterworfen hat.
.Es war lediglich die Kunst seiner Fragestellung,
die es mir ermöglichte, ihm tausend Dinge auf‐
zuklären, die mir jedem anderen Menschen ge‐
genüber als unsagbar erschienen wären.
nur sagen, daß es mit einer Einfühlungssicherheit
und genialen Erfassung des Wesentlichen ge‐
schrieben ist, die für mein eigenes Urteil sicher
ans Wunderbare grenzt.
was mir selbst immer unaussprechlich schien.
schlag des Stahles springt der Funke nicht aus
dem Feuerstein. ‒ ‒
Maler Bô Yin Râ geschrieben hat, eigentlich recht
«böse» sein, denn er hat mich bis aufs Blut ge‐
quält, um alles das aus mir heraus zu holen, was er
für sein Buch zu brauchen glaubte.
beit zwingt mich denn doch, ihm vor aller Öffent‐
lichkeit für die Tortur zu danken, der er mich so
manchen Achtstundentag und manche Nacht‐
stunde hindurch mit unerbittlicher Grausamkeit
unterworfen hat.
die es mir ermöglichte, ihm tausend Dinge auf‐
zuklären, die mir jedem anderen Menschen ge‐
genüber als unsagbar erschienen wären.
.So kam ein Material zutage, dessen Fülle mich
selbst in Erstaunen versetzte.
.Aber gerade auf dieses Material hatte es Schott
abgesehen, und mit intuitiver Sicherheit wußte er
daraus sein einzigartiges Buch zu gestalten.
.Möge es allen die Augen öffnen, die sehen ler‐
nen wollen!
.Ich habe nichts Besseres in ihre Hand zu ge‐
ben. ‒ ‒
.Daß in dem Buche nichts besprochen ist, was
nicht auch bildhaft dargestellt wäre, dürfte zweifel‐
los als besonderer Vorzug zu betrachten sein.
.Sollte man mehr in dieser Art erwarten, so wird
der Autor auch noch mehr zu sagen und zu zeigen
haben, obwohl er bereits hier wahrlich überrei‐
chen Stoff zum Nachdenken und Nachfühlen bie‐
tet.
.Ich begrüße dieses Buch als Wegweiser für Tau‐
sende, ganz abgesehen davon, daß es ein wahrhaft
zuverläßiger «Cicerone» ist in den Gebieten geisti‐
ger Kunst!
.Dem Kunstverlag Hanfstaengl aber weiß ich
Dank für die vorzügliche Ausstattung.
selbst in Erstaunen versetzte.
abgesehen, und mit intuitiver Sicherheit wußte er
daraus sein einzigartiges Buch zu gestalten.
nen wollen!
ben. ‒ ‒
nicht auch bildhaft dargestellt wäre, dürfte zweifel‐
los als besonderer Vorzug zu betrachten sein.
der Autor auch noch mehr zu sagen und zu zeigen
haben, obwohl er bereits hier wahrlich überrei‐
chen Stoff zum Nachdenken und Nachfühlen bie‐
tet.
sende, ganz abgesehen davon, daß es ein wahrhaft
zuverläßiger «Cicerone» ist in den Gebieten geisti‐
ger Kunst!
Dank für die vorzügliche Ausstattung.
Auf eine Anfrage an Bô Yin Râ, ob es ihm unerwünscht er‐ 00
scheinen würde, wenn wir das in unserem Verlag (Richard 00
Hummel Verlag, Leipzig) seinerzeit erschienene obenge‐ 00
nannte Brevier weiter propagierten, bzw. ob es durch 00
seine Bücher unnötig sei und forthin zurückzuziehen 00
wäre, erhielten wir nachfolgend wiedergegebene Ant‐ 00
wort:
scheinen würde, wenn wir das in unserem Verlag (Richard 00
Hummel Verlag, Leipzig) seinerzeit erschienene obenge‐ 00
nannte Brevier weiter propagierten, bzw. ob es durch 00
seine Bücher unnötig sei und forthin zurückzuziehen 00
wäre, erhielten wir nachfolgend wiedergegebene Ant‐ 00
wort:
.Ihre Anfrage kommt mir durchaus nicht über‐
raschend, denn auch bei mir sind im Laufe der
Zeit zahlreiche und einander stark widerspre‐
chende Urteile eingelaufen.
zuliegen, sowohl bei den begeisterten Freunden
des «Breviers», wie bei seinen Kritikern, die gewiß
formal im Recht sind, wenn sie dagegen geltend
machen, daß man ‒ herkömmlicherweise ‒ soge‐
nannte «Breviere» erst dann zusammenstelle,
wenn man das Lebenswerk eines Autors als ab‐
geschlossen betrachten dürfe. Jedoch folgt aus
solchem Herkommen keinerlei Gesetz! Es ist
nicht einzusehen, weshalb man nicht aus jedem
vorliegenden reichlichen Material an Sentenzen
ein Buch zusammenstellen dürfte, einerlei, ob der
Autor schon verstorben ist oder noch im Schaffen
steht. An sich bedeutet ein Kurzbuch mit gesam‐
melten Aussprüchen ja noch nichts Abschließen‐
des. Meines Erachtens ist ein solches Buch überall
da berechtigt, wo eine größere Reihe von Senten‐
zen jederzeit leicht zugänglich gemacht werden
soll, einerlei ob von der gleichen Stelle her noch
weiterhin Produktives ausgeht oder ob man vor
einem bereits abgeschlossenen Lebenswerke
steht.
Was aber nun das von Rudolf Schott aus meinen
Werken zusammengestellte «Brevier» angeht, so
liegt da ein Sonderfall vor, der eigentlich vielleicht
von Anfang an einer Erläuterung bedurft hätte,
denn meines Wissens kam es dem feinsinnigen
Autor des Ludwig-Richter-Buches und der «Reise
in Italien», der das ausgezeichnete Wort von der
«inwendigen Antike» geprägt hat, viel weniger auf
eine Sentenzensammlung an als eben um das Auf‐
zeigen dieser von ihm auch in meinen Werken er‐
fühlten «inwendigen Antike» unter Benutzung
meiner eigenen Worte, die hier gleichzeitig das
Aufgezeigte bestätigen sollten.
vorliegenden reichlichen Material an Sentenzen
ein Buch zusammenstellen dürfte, einerlei, ob der
Autor schon verstorben ist oder noch im Schaffen
steht. An sich bedeutet ein Kurzbuch mit gesam‐
melten Aussprüchen ja noch nichts Abschließen‐
des. Meines Erachtens ist ein solches Buch überall
da berechtigt, wo eine größere Reihe von Senten‐
zen jederzeit leicht zugänglich gemacht werden
soll, einerlei ob von der gleichen Stelle her noch
weiterhin Produktives ausgeht oder ob man vor
einem bereits abgeschlossenen Lebenswerke
steht.
Werken zusammengestellte «Brevier» angeht, so
liegt da ein Sonderfall vor, der eigentlich vielleicht
von Anfang an einer Erläuterung bedurft hätte,
denn meines Wissens kam es dem feinsinnigen
Autor des Ludwig-Richter-Buches und der «Reise
in Italien», der das ausgezeichnete Wort von der
«inwendigen Antike» geprägt hat, viel weniger auf
eine Sentenzensammlung an als eben um das Auf‐
zeigen dieser von ihm auch in meinen Werken er‐
fühlten «inwendigen Antike» unter Benutzung
meiner eigenen Worte, die hier gleichzeitig das
Aufgezeigte bestätigen sollten.
.Gewiß dachte er daneben auch daran, daß die
gegebenen Zitate manchem Leser meiner Werke
zuweilen schon an sich willkommen sein könnten,
‒ so etwa auf Reisen, wo die Bücher nicht alle mit‐
geführt werden, ‒ oder auch um Neulingen einen
bequemen Überblick verschaffen zu können über
die Begriffs- und Gedankenkreise, die mein Leh‐
ren umfaßt. Er hat das ja auch in seiner, übrigens
im Hauptinhalt wirklich ganz einzigartig bedeu‐
tungsvollen «Einführung» nebenher erwähnt.
Aber weitaus wichtiger war ihm natürlich doch
das, was er in den von ihm gewählten Zusammen‐
fassungen mit meinen Worten aufzeigen wollte.
Das erklärt auch seine Wahl der einzelnen Be‐
griffe, durch die er meine Aussprüche zusam‐
menbündelt, wie «Geist», «Seele», «Körper»,
«Ich», «Du» u.s.f., wie auch die nicht immer gleich
erkundbare Motivierung für die mitunter schein‐
bar kaum gerechtfertigte Einbeziehung von ein‐
zelnen Aussprüchen, die ich vielleicht selber in ei‐
ner bloßen Sentenzen-Anthologie nicht als beson‐
derer Hervorhebung entsprechend erachtet
hätte. Als ich aber einmal während unfreiwilliger
Bettruhe die Möglichkeit fand, alles sorgfältig
kontrollierend durchzulesen, blieb kein einziges
Zitat übrig, von dem ich noch weiterhin geurteilt
hätte, daß es an seiner Stelle überflüßig sei. Es
wird auch das zuerst Befremdende sogleich deut‐
gegebenen Zitate manchem Leser meiner Werke
zuweilen schon an sich willkommen sein könnten,
‒ so etwa auf Reisen, wo die Bücher nicht alle mit‐
geführt werden, ‒ oder auch um Neulingen einen
bequemen Überblick verschaffen zu können über
die Begriffs- und Gedankenkreise, die mein Leh‐
ren umfaßt. Er hat das ja auch in seiner, übrigens
im Hauptinhalt wirklich ganz einzigartig bedeu‐
tungsvollen «Einführung» nebenher erwähnt.
Aber weitaus wichtiger war ihm natürlich doch
das, was er in den von ihm gewählten Zusammen‐
fassungen mit meinen Worten aufzeigen wollte.
Das erklärt auch seine Wahl der einzelnen Be‐
griffe, durch die er meine Aussprüche zusam‐
menbündelt, wie «Geist», «Seele», «Körper»,
«Ich», «Du» u.s.f., wie auch die nicht immer gleich
erkundbare Motivierung für die mitunter schein‐
bar kaum gerechtfertigte Einbeziehung von ein‐
zelnen Aussprüchen, die ich vielleicht selber in ei‐
ner bloßen Sentenzen-Anthologie nicht als beson‐
derer Hervorhebung entsprechend erachtet
hätte. Als ich aber einmal während unfreiwilliger
Bettruhe die Möglichkeit fand, alles sorgfältig
kontrollierend durchzulesen, blieb kein einziges
Zitat übrig, von dem ich noch weiterhin geurteilt
hätte, daß es an seiner Stelle überflüßig sei. Es
wird auch das zuerst Befremdende sogleich deut‐
lich, wenn man sich klar macht, daß die Aussprü‐
che dazu dienen sollen, mein Verkündungswerk
von verschiedenen Seiten her in klarer Kontur fassen
zu lehren.
Gelegentlich ist mir in kritischen Äußerungen
über das vermeintlich «überflüssige» ‒ in Wahr‐
heit aber so überaus zum Nachdenken anregende
und seelisch fördernde ‒ Werkchen, das da, unter
Benutzung meiner Worte, über meine Bücher ge‐
schrieben ist, und vielleicht das Authentischste
darstellt, was von einem Anderen darüber ge‐
schrieben werden kann, ‒ auch der Einwand be‐
gegnet, es seien doch auch Stellen gebraucht, die
in späteren Neuausgaben mehrerer Bücher end‐
gültig eine andere Fassung erhalten haben. Die‐
ser Einwand kommt aber nur zustande durch die
recht merkwürdige Annahme, als bilde die endgül‐
tige Formung, wo sie von mir für notwendig ge‐
halten wurde, etwa gar eine Negierung der vorher
gebrauchten Formulierung. Wer zu solcher An‐
sicht neigt, dem muß ich jedoch hier eindeutig sa‐
gen, daß ich selbstverständlich zu jedem Wort
stehe, das ich jemals in die Öffentlichkeit gegeben
habe, so daß die späterhin erfolgte Andersformu‐
lierung natürlich niemals das zuerst gegebene
Wort von meiner Verantwortung ablösen könnte.
che dazu dienen sollen, mein Verkündungswerk
von verschiedenen Seiten her in klarer Kontur fassen
zu lehren.
über das vermeintlich «überflüssige» ‒ in Wahr‐
heit aber so überaus zum Nachdenken anregende
und seelisch fördernde ‒ Werkchen, das da, unter
Benutzung meiner Worte, über meine Bücher ge‐
schrieben ist, und vielleicht das Authentischste
darstellt, was von einem Anderen darüber ge‐
schrieben werden kann, ‒ auch der Einwand be‐
gegnet, es seien doch auch Stellen gebraucht, die
in späteren Neuausgaben mehrerer Bücher end‐
gültig eine andere Fassung erhalten haben. Die‐
ser Einwand kommt aber nur zustande durch die
recht merkwürdige Annahme, als bilde die endgül‐
tige Formung, wo sie von mir für notwendig ge‐
halten wurde, etwa gar eine Negierung der vorher
gebrauchten Formulierung. Wer zu solcher An‐
sicht neigt, dem muß ich jedoch hier eindeutig sa‐
gen, daß ich selbstverständlich zu jedem Wort
stehe, das ich jemals in die Öffentlichkeit gegeben
habe, so daß die späterhin erfolgte Andersformu‐
lierung natürlich niemals das zuerst gegebene
Wort von meiner Verantwortung ablösen könnte.
Insofern stellt also Schotts «Brevier» geradezu
den Beweis dafür dar, daß die mittlerweile in
Neuausgaben einzelner meiner Bücher getroffe‐
nen Neuformulierungen natürlich nichts am Sinn
des Ganzen verändert haben.
.Aus all dem Vorstehenden werden Sie gewiß
schon ersehen, daß ich das unter Verwendung
meiner eigenen Worte seinerzeit von Rudolf
Schott gestaltete Erläuterungswerk zu meinen
Büchern, das er als «Brevier» herausgab, ganz ge‐
wiß nicht für etwas Überflüssiges halten kann. Na‐
türlich will und kann dieses Buch, auch wenn es
das, was Schott die «inwendige Antike» nennt, an
meinen eigenen Worten aufzeigt, niemals auch nur
eines meiner Bücher «ersetzen», aber man würde
sich ja auch einer kuriosen Vorstellung hingeben,
wenn man der törichten Annahme Raum lassen
wollte, als wäre die doch von mir gutgeheißene Ent‐
stehung des «Breviers» der Absicht zu verdanken,
einen «Ersatz» für meine Bücher zu schaffen.
.Ich bin Ihnen nur dankbar, wenn Sie dem «Bre‐
vier» auch weiterhin die Wege zu denen offenhal‐
ten wollen, die es brauchen können, was von jedem
Leser meiner Bücher mit Bestimmtheit zu sagen
ist! Freilich sollte kein Benützer dieses «Breviers»
darin nur eine bloße Anthologie sehen, sondern
in erster Linie ein in acht Kapiteln bewußt aus
den Beweis dafür dar, daß die mittlerweile in
Neuausgaben einzelner meiner Bücher getroffe‐
nen Neuformulierungen natürlich nichts am Sinn
des Ganzen verändert haben.
schon ersehen, daß ich das unter Verwendung
meiner eigenen Worte seinerzeit von Rudolf
Schott gestaltete Erläuterungswerk zu meinen
Büchern, das er als «Brevier» herausgab, ganz ge‐
wiß nicht für etwas Überflüssiges halten kann. Na‐
türlich will und kann dieses Buch, auch wenn es
das, was Schott die «inwendige Antike» nennt, an
meinen eigenen Worten aufzeigt, niemals auch nur
eines meiner Bücher «ersetzen», aber man würde
sich ja auch einer kuriosen Vorstellung hingeben,
wenn man der törichten Annahme Raum lassen
wollte, als wäre die doch von mir gutgeheißene Ent‐
stehung des «Breviers» der Absicht zu verdanken,
einen «Ersatz» für meine Bücher zu schaffen.
vier» auch weiterhin die Wege zu denen offenhal‐
ten wollen, die es brauchen können, was von jedem
Leser meiner Bücher mit Bestimmtheit zu sagen
ist! Freilich sollte kein Benützer dieses «Breviers»
darin nur eine bloße Anthologie sehen, sondern
in erster Linie ein in acht Kapiteln bewußt aus
meinen Worten gestaltetes Buch über mein Ver‐
kündungswerk, das ihm für sehr vieles in meinen
Büchern die Augen öffnen kann. Auch die «Ein‐
führung» Schotts ist dabei gewiß nicht auszuneh‐
men!
kündungswerk, das ihm für sehr vieles in meinen
Büchern die Augen öffnen kann. Auch die «Ein‐
führung» Schotts ist dabei gewiß nicht auszuneh‐
men!
BÔ YIN RÂ bittet um Veröffentlichung nachfolgender Zeilen:
.«Je mehr meine Bücher zu einem wertvollen
Besitz vieler Leser werden, desto ungeheuerli‐
cher häuft sich die Masse der Zuschriften, die mir
direkt oder durch Verlagsvermittlung zugehen,
entweder um Dank und Freude Ausdruck zu ge‐
ben, oder um persönliche Fragen zu stellen.
.Anfänglich versuchte ich, alle derartigen Briefe
gewissenhaft zu beantworten; wollte ich aber auch
weiter bei dieser Gepflogenheit bleiben, dann
müßte ich jede andere Tätigkeit einstellen und könnte
dennoch die Stöße von Briefen nicht auf solche
Weise beantworten, wie es meinem Empfinden
und meinem Willen, Hilfe zu bringen, entspre‐
chen würde. ‒
.Es ist im übrigen bis auf den heutigen Tag noch
keine einzige Anfrage an mich ergangen, auf die
sich der Fragende mit einigem guten Willen und
Besitz vieler Leser werden, desto ungeheuerli‐
cher häuft sich die Masse der Zuschriften, die mir
direkt oder durch Verlagsvermittlung zugehen,
entweder um Dank und Freude Ausdruck zu ge‐
ben, oder um persönliche Fragen zu stellen.
gewissenhaft zu beantworten; wollte ich aber auch
weiter bei dieser Gepflogenheit bleiben, dann
müßte ich jede andere Tätigkeit einstellen und könnte
dennoch die Stöße von Briefen nicht auf solche
Weise beantworten, wie es meinem Empfinden
und meinem Willen, Hilfe zu bringen, entspre‐
chen würde. ‒
keine einzige Anfrage an mich ergangen, auf die
sich der Fragende mit einigem guten Willen und
etwas Nachsinnen, auf Grund logischer Folge‐
rungen aus den durch mich gegebenen Lehren,
nicht selbst die Antwort hätte geben können...
.Jene anderen zahllosen Zuschriften aber, die
nur dem Dank und der Freude, oder der inneren
Zustimmung des Herzens Ausdruck geben sollen,
muß ich leider gleichfalls fürderhin unbeantwor‐
tet lassen, obwohl ich gewiß gern jedem einzelnen
Briefschreiber von Herzen danken möchte.
.Vielfach scheinen die Absender der an mich ge‐
richteten Briefe anzunehmen, daß die Einsendung
des Rückportos alle der Antwort im Wege stehenden
Umstände beseitigen müsse. Gern wollte ich je‐
doch die Portospesen tragen, sähe ich überhaupt
noch eine Möglichkeit, all diese Briefe zu beantwor‐
ten, ohne meine anderen bindenden Lebens‐
pflichten zu vernachläßigen, ja gänzlich unerfüllt
zu lassen.
.Allen, die in den letzten Monaten an mich ge‐
schrieben haben und keine Antwort mehr erhal‐
ten konnten, sage ich hiermit herzlichen Dank
und bitte zugleich, die Nichtbeantwortung nicht
als Zeichen der mangelnden Anteilnahme an dem
jeweiligen Einzelschicksal auslegen zu wollen! ‒
.Ich bin kaum mehr imstande, auch nur alles zu
lesen, was man mir zuschickt, und ich glaube
rungen aus den durch mich gegebenen Lehren,
nicht selbst die Antwort hätte geben können...
nur dem Dank und der Freude, oder der inneren
Zustimmung des Herzens Ausdruck geben sollen,
muß ich leider gleichfalls fürderhin unbeantwor‐
tet lassen, obwohl ich gewiß gern jedem einzelnen
Briefschreiber von Herzen danken möchte.
richteten Briefe anzunehmen, daß die Einsendung
des Rückportos alle der Antwort im Wege stehenden
Umstände beseitigen müsse. Gern wollte ich je‐
doch die Portospesen tragen, sähe ich überhaupt
noch eine Möglichkeit, all diese Briefe zu beantwor‐
ten, ohne meine anderen bindenden Lebens‐
pflichten zu vernachläßigen, ja gänzlich unerfüllt
zu lassen.
schrieben haben und keine Antwort mehr erhal‐
ten konnten, sage ich hiermit herzlichen Dank
und bitte zugleich, die Nichtbeantwortung nicht
als Zeichen der mangelnden Anteilnahme an dem
jeweiligen Einzelschicksal auslegen zu wollen! ‒
lesen, was man mir zuschickt, und ich glaube
nichts Unmögliches zu erwarten, wenn ich an‐
nehme, daß man bei einiger Überlegung begrei‐
fen wird, wie vieles durch meine Geistesarbeit ge‐
tan sein will, und daß auch ich nicht in der Lage
bin, zu gleicher Zeit den mir übertragenen Pflich‐
ten zu genügen, wenn ich von Sonnenaufgang bis
zur Mitternacht nur Zuschriften beantworten
wollte.»
nehme, daß man bei einiger Überlegung begrei‐
fen wird, wie vieles durch meine Geistesarbeit ge‐
tan sein will, und daß auch ich nicht in der Lage
bin, zu gleicher Zeit den mir übertragenen Pflich‐
ten zu genügen, wenn ich von Sonnenaufgang bis
zur Mitternacht nur Zuschriften beantworten
wollte.»
BÔ YIN RÂ ersucht uns um die Verbreitung folgender Mitteilung:
.In den letzten Jahrgängen der «Säule» (bzw.
der «Magischen Blätter») waren zahlreiche Bei‐
träge von mir zu finden, so daß es manchen Le‐
sern zuletzt als ganz selbstverständlich erschien,
daß sie in jeder Nummer der Zeitschrift meinen
Abhandlungen begegnen müßten.
.Nun liegt es aber gewiß nicht in der Art meines
Lehrauftrags, die Mitarbeit an Zeitschriften zu er‐
streben, sondern es hatte sich zwanglos aus dem
freundschaftlichen und Schülerverhältnis des
Herausgebers und Verlegers der «Säule» zu mir
ergeben, daß ich dieser seiner Zeitschrift einzelne
in sich geschlossene Teile meiner für zukünftiges
Erscheinen in Buchform vorbereiteten Schriften
zum Vorabdruck überließ.
.Gelegentlich nur kamen auch Themen zur Be‐
handlung, die der Tag nahegelegt hatte und über
der «Magischen Blätter») waren zahlreiche Bei‐
träge von mir zu finden, so daß es manchen Le‐
sern zuletzt als ganz selbstverständlich erschien,
daß sie in jeder Nummer der Zeitschrift meinen
Abhandlungen begegnen müßten.
Lehrauftrags, die Mitarbeit an Zeitschriften zu er‐
streben, sondern es hatte sich zwanglos aus dem
freundschaftlichen und Schülerverhältnis des
Herausgebers und Verlegers der «Säule» zu mir
ergeben, daß ich dieser seiner Zeitschrift einzelne
in sich geschlossene Teile meiner für zukünftiges
Erscheinen in Buchform vorbereiteten Schriften
zum Vorabdruck überließ.
handlung, die der Tag nahegelegt hatte und über
die ich mich den Lesern der Zeitschrift gegenüber
äußern wollte.
.Niemals aber war es von mir beabsichtigt, mei‐
nerseits die «Magischen Blätter» oder die «Säule»
ad infinitum mit Beiträgen versehen zu wollen,
sondern ich hoffte stets darauf, daß sich ein Stab
gediegener Mitarbeiter zusammenschließen
möge um mir die Mitsorge für die als nötig und
bedeutsam erachtete Zeitschrift abzunehmen.
.Mehr und mehr fand diese Hoffnung auch ihre
Erfüllung, und gleichzeitig plante der Verlag eine
gewiße Neugestaltung der «Säule», wie sie der
laufende neunte Jahrgang bereits erfreulicher‐
weise zeigt.
.Hier war die Zeit meiner Entlastung nun ge‐
kommen und wenn ich auch wußte, daß ein künf‐
tiger Ausfall meiner Beiträge vorerst zu allerlei
Legendenbildungen Anlaß werden könne, so
durfte ich mir doch auch sagen, daß alle einsichti‐
gen Leser alsbald auf die Spur der wahren Gründe
meines Zurücktretens als «Mitarbeiter» der Zeit‐
schrift geführt würden, die mir so nahe steht wie
je zuvor.
.Was mir aber da und dort neuerlich zu Ohren
kommt, läßt es mir nachgerade als Pflicht erschei‐
nen, den Lesern der «Säule» klar und deutlich zu
äußern wollte.
nerseits die «Magischen Blätter» oder die «Säule»
ad infinitum mit Beiträgen versehen zu wollen,
sondern ich hoffte stets darauf, daß sich ein Stab
gediegener Mitarbeiter zusammenschließen
möge um mir die Mitsorge für die als nötig und
bedeutsam erachtete Zeitschrift abzunehmen.
Erfüllung, und gleichzeitig plante der Verlag eine
gewiße Neugestaltung der «Säule», wie sie der
laufende neunte Jahrgang bereits erfreulicher‐
weise zeigt.
kommen und wenn ich auch wußte, daß ein künf‐
tiger Ausfall meiner Beiträge vorerst zu allerlei
Legendenbildungen Anlaß werden könne, so
durfte ich mir doch auch sagen, daß alle einsichti‐
gen Leser alsbald auf die Spur der wahren Gründe
meines Zurücktretens als «Mitarbeiter» der Zeit‐
schrift geführt würden, die mir so nahe steht wie
je zuvor.
kommt, läßt es mir nachgerade als Pflicht erschei‐
nen, den Lesern der «Säule» klar und deutlich zu
sagen, wie ferne der Wahrheit alle Vermutungen
sind, die aus dem Fehlen meiner Beiträge auf ir‐
gendwelche Veränderung meiner Wertschätzung
der Zeitschrift oder gar ihres Herausgebers und
Verlegers schließen möchten!
.Ich stehe der Neugestaltung der «Säule» seit
Beginn des laufenden neunten Jahrgangs sogar
mit besonderer Sympathie gegenüber und bin si‐
cher, daß Herausgeber und Mitarbeiter auf dem
nun betretenen Wege immer Besseres schaffen, im‐
mer mehr segensreiche Klärung bringen werden.
.Was ich persönlich den Lesern der «Säule» zu sa‐
gen habe, ist allein in meinen Büchern zu finden und
soll nur dort gesucht werden!
.Die Zeitschrift hat nicht den Zweck, mich zu
Wort kommen zu lassen, sondern soll durch dazu
Berufene, ‒ aber auch nur durch solche! ‒ Fragen
der Lebenspraxis, Probleme der Vorstellung und
der zeitgegebenen Mentalität im Lichte der durch
mein Wirken verbreiteten Lehren klären helfen, ‒ soll
aufzeigen, wie die unerschütterbare Wahrheit dieser
Lehren den nach ihnen Lebenden offenbar und bestim‐
mend wurde. ‒
.Längst gemahnt, meine physische Gesundheit
nicht ganz außer acht zu laßen, die durch eine al‐
len Nahestehenden bekannte, beispiellose Ar‐
sind, die aus dem Fehlen meiner Beiträge auf ir‐
gendwelche Veränderung meiner Wertschätzung
der Zeitschrift oder gar ihres Herausgebers und
Verlegers schließen möchten!
Beginn des laufenden neunten Jahrgangs sogar
mit besonderer Sympathie gegenüber und bin si‐
cher, daß Herausgeber und Mitarbeiter auf dem
nun betretenen Wege immer Besseres schaffen, im‐
mer mehr segensreiche Klärung bringen werden.
gen habe, ist allein in meinen Büchern zu finden und
soll nur dort gesucht werden!
Wort kommen zu lassen, sondern soll durch dazu
Berufene, ‒ aber auch nur durch solche! ‒ Fragen
der Lebenspraxis, Probleme der Vorstellung und
der zeitgegebenen Mentalität im Lichte der durch
mein Wirken verbreiteten Lehren klären helfen, ‒ soll
aufzeigen, wie die unerschütterbare Wahrheit dieser
Lehren den nach ihnen Lebenden offenbar und bestim‐
mend wurde. ‒
nicht ganz außer acht zu laßen, die durch eine al‐
len Nahestehenden bekannte, beispiellose Ar‐
beitsüberbürdung und stete Sorge um Andere
seit Jahren um ihre primitivsten Rechte kam, muß
ich auch die äußeren Bedingungen zu erhalten
suchen um alle Kraft auf das Werk konzentrieren zu
können, das mir zu vollbringen geboten ist und
das wahrlich den ganzen Menschen verlangt...
.Daß die Nötigung, einzelne Teile aus noch un‐
vollendeten Schriften in den Vorabdruck hinzu‐
geben, zur quälenden Störung der Arbeit an der
Endgestaltung einer Schrift werden kann, brau‐
che ich wohl keinem Menschen zu sagen, der die
Bedingungen geistigen Schaffens auch nur von
ferne erahnt. ‒
.Manches ist mir so in den Jahren meiner
«Mitarbeit» an der Zeitschrift verlorengegangen,
was ich bis heute noch nicht wiederbringen
konnte. ‒ ‒
.Unmöglich aber wäre es mir, außer allem ande‐
ren Tun das meine Kräfte braucht, noch beson‐
dere Abhandlungen, nur für die «Säule» be‐
stimmt, zu formen, und wie ich oben dargelegt zu
haben glaube, ist es auch gewiß nicht mehr von‐
nöten.
.Hier sollen nun Menschen sprechen, die in sich
erlebten, was meine Schriften sie erleben lehrten,
seit Jahren um ihre primitivsten Rechte kam, muß
ich auch die äußeren Bedingungen zu erhalten
suchen um alle Kraft auf das Werk konzentrieren zu
können, das mir zu vollbringen geboten ist und
das wahrlich den ganzen Menschen verlangt...
vollendeten Schriften in den Vorabdruck hinzu‐
geben, zur quälenden Störung der Arbeit an der
Endgestaltung einer Schrift werden kann, brau‐
che ich wohl keinem Menschen zu sagen, der die
Bedingungen geistigen Schaffens auch nur von
ferne erahnt. ‒
«Mitarbeit» an der Zeitschrift verlorengegangen,
was ich bis heute noch nicht wiederbringen
konnte. ‒ ‒
ren Tun das meine Kräfte braucht, noch beson‐
dere Abhandlungen, nur für die «Säule» be‐
stimmt, zu formen, und wie ich oben dargelegt zu
haben glaube, ist es auch gewiß nicht mehr von‐
nöten.
erlebten, was meine Schriften sie erleben lehrten,
und die befähigt sind in Wortgestalt zu formen was
sie innerlich erfüllt.
.Alle Unfähigkeit zur Darstellung, ‒ alle Unzuläng‐
lichkeit der Gestaltung aber möge diesen Blättern
fernebleiben, und jeder der an ihnen mitzuarbeiten
berufen ist, sei stets sich der Verantwortung bewußt,
die jeder übernimmt, der Anderen auf seine Weise
Hilfe bringen will, damit auch ihnen nach der
Weise ihrer Seele Licht und Wahrheit werde. ‒ ‒
sie innerlich erfüllt.
lichkeit der Gestaltung aber möge diesen Blättern
fernebleiben, und jeder der an ihnen mitzuarbeiten
berufen ist, sei stets sich der Verantwortung bewußt,
die jeder übernimmt, der Anderen auf seine Weise
Hilfe bringen will, damit auch ihnen nach der
Weise ihrer Seele Licht und Wahrheit werde. ‒ ‒
HIER sollte der mir freundschaftlich naheste‐
hende Herausgeber der «Säule» eigentlich
weghören, denn was ich sagen will, gilt zwar ihm
und seiner Arbeit, geht aber mehr seine Freunde
und vielleicht ‒ auch Feinde ‒ an, als ihn selbst.
.Was ich ihm selbst zu sagen hatte, ob es nun An‐
erkennung war oder zuweilen auch ernste Kritik,
das hat er stets in direkter Aussprache erfahren,
und so wird er auch heute wieder von mir hören
wie ich's meine, ohne daß ich dazu des freundli‐
chen Setzers Mithilfe in Anspruch nehmen
möchte.
.Ich will hier nur zu den Lesern dieser Zeit‐
schrift sprechen, die mit dem vorliegenden Heft
ihren zehnten Jahrgang erfolgreich vollendet.
.Mit der Zeitschrift feiert zugleich ihr Verlag sein
zehnjähriges Bestehen.
.Was das in so schwerer Zeit heißen will, wissen
am besten die dem Buchhandel Nahestehenden,
hende Herausgeber der «Säule» eigentlich
weghören, denn was ich sagen will, gilt zwar ihm
und seiner Arbeit, geht aber mehr seine Freunde
und vielleicht ‒ auch Feinde ‒ an, als ihn selbst.
erkennung war oder zuweilen auch ernste Kritik,
das hat er stets in direkter Aussprache erfahren,
und so wird er auch heute wieder von mir hören
wie ich's meine, ohne daß ich dazu des freundli‐
chen Setzers Mithilfe in Anspruch nehmen
möchte.
schrift sprechen, die mit dem vorliegenden Heft
ihren zehnten Jahrgang erfolgreich vollendet.
zehnjähriges Bestehen.
am besten die dem Buchhandel Nahestehenden,
die während dieser zehn Jahre so viele Verlage
und Zeitschriften entstehen, aber auch alsbald
wieder verschwinden sahen. ‒ ‒
.Es ist gewiß leicht, an der allgemeinen Berufs‐
tätigkeit eines Verlegers, und noch leichter, an ei‐
ner von ihm herausgegebenen Zeitschrift Kritik zu
üben, aber oft recht schwer, der trotz allem Anlaß
zur Kritik dennoch geleisteten positiven Arbeit ge‐
recht zu werden.
.Auch ich konnte mich in Sachen der «Säule» ge‐
wiß nicht immer einer wohlwollenden Kritik ent‐
halten, ‒ auch mir erschien gewiß nicht jeder Bei‐
trag, dem die Zeitschrift Raum gab, der Auf‐
nahme würdig, und noch weniger konnte ich eine
allzu weitherzige Liberalität gutheißen, die in der
Aufnahme von Beilagen oder auch redaktionell
befürworteten Buchanzeigen zum Ausdruck
kam, und zu der sich der Verleger für beruflich
verpflichtet halten mochte.
.Ich muß aber nachdrücklichst dennoch beto‐
nen, daß es recht verkehrt wäre, aus solchen sicht‐
lichen Mißgriffen heraus voreilige Schlüsse zu zie‐
hen und die geistige Einstellung des Herausge‐
bers, der hier sein eigener Verleger ist, besorgt in
Frage zu stellen.
.Ich weiß, daß stets nur das Beste erstrebt
wurde, auch dann, wenn die Wohlmeinenden
und Zeitschriften entstehen, aber auch alsbald
wieder verschwinden sahen. ‒ ‒
tätigkeit eines Verlegers, und noch leichter, an ei‐
ner von ihm herausgegebenen Zeitschrift Kritik zu
üben, aber oft recht schwer, der trotz allem Anlaß
zur Kritik dennoch geleisteten positiven Arbeit ge‐
recht zu werden.
wiß nicht immer einer wohlwollenden Kritik ent‐
halten, ‒ auch mir erschien gewiß nicht jeder Bei‐
trag, dem die Zeitschrift Raum gab, der Auf‐
nahme würdig, und noch weniger konnte ich eine
allzu weitherzige Liberalität gutheißen, die in der
Aufnahme von Beilagen oder auch redaktionell
befürworteten Buchanzeigen zum Ausdruck
kam, und zu der sich der Verleger für beruflich
verpflichtet halten mochte.
nen, daß es recht verkehrt wäre, aus solchen sicht‐
lichen Mißgriffen heraus voreilige Schlüsse zu zie‐
hen und die geistige Einstellung des Herausge‐
bers, der hier sein eigener Verleger ist, besorgt in
Frage zu stellen.
wurde, auch dann, wenn die Wohlmeinenden
schärfste Kritik üben zu müssen meinten und oft
auch mich auf ihrer Seite fanden.
.Nicht umsonst stehe ich bis auf d. heutigen Tag die‐
ser Zeitschrift mit allem Vertrauen und mit den wärm‐
sten Wünschen für ihr ferneres Gedeihen gegenüber!
.Nicht umsonst verbindet mich aufrichtigste Be‐
freundung und Hochschätzung mit ihrem Her‐
ausgeber und Verleger!
.Nur zu gut kenne ich die großen Schwierigkei‐
ten, denen sein lauterer Wille sich in diesen zehn
Jahren immer wieder gegenüber sah, und ebenso
weiß ich, daß so manches, was andere zur Kritik
nötigte, auch von ihm nicht gebilligt wurde,
mochte er es auch, der Macht äußerer Verhält‐
nisse gegenüber, nicht verhüten können.
.Es steckt eine immense Arbeit und ein ganz un‐
gewöhnliches Maß freudiger Hingebung in die‐
sen zehn Jahrgängen der Zeitschrift und der
gleichzeitigen Verlagsentwicklung, ganz abgese‐
hen von dem tiefen Bewußtsein, durch das alles
mit den eigenen Kräften der Ausbreitung geisti‐
gen Lichtes zu dienen!
.Die in solcher Weise betriebene Treue der ein‐
mal gestellten Aufgabe gegenüber, verdient um so
mehr Anerkennung, weil es sich im wesentlichen
auch mich auf ihrer Seite fanden.
ser Zeitschrift mit allem Vertrauen und mit den wärm‐
sten Wünschen für ihr ferneres Gedeihen gegenüber!
freundung und Hochschätzung mit ihrem Her‐
ausgeber und Verleger!
ten, denen sein lauterer Wille sich in diesen zehn
Jahren immer wieder gegenüber sah, und ebenso
weiß ich, daß so manches, was andere zur Kritik
nötigte, auch von ihm nicht gebilligt wurde,
mochte er es auch, der Macht äußerer Verhält‐
nisse gegenüber, nicht verhüten können.
gewöhnliches Maß freudiger Hingebung in die‐
sen zehn Jahrgängen der Zeitschrift und der
gleichzeitigen Verlagsentwicklung, ganz abgese‐
hen von dem tiefen Bewußtsein, durch das alles
mit den eigenen Kräften der Ausbreitung geisti‐
gen Lichtes zu dienen!
mal gestellten Aufgabe gegenüber, verdient um so
mehr Anerkennung, weil es sich im wesentlichen
hier stets nur um ein Wirken aus idealer Intention
handelte, die bei allem, was sie erstrebte, das ma‐
teriell Mögliche streng im Auge behalten mußte.
.Allzuwenig wird beachtet, daß es sich hier um
eine Zeitschrift handelt, die einer noch keines‐
wegs konventionell ausgemünzten Form geistiger
Erkenntnisse Ausbreitung zu schaffen sucht, so
daß es überaus schwer hält, die wirklich geeigne‐
ten und allen Einwänden überlegenen Mitarbei‐
ter zu erlangen.
.Ebensowenig aber ist man sich auch der Tatsa‐
che bewußt, daß der Bezugspreis einer Zeitschrift,
die sich nach Möglichkeit von artfremden Insera‐
ten und Beilagen freihalten soll, kaum die Druck‐
und Versandkosten deckt, so daß es der Beihilfe
vieler, die heute noch lässig, wenn auch wohlmei‐
nend und kritikbereit zur Seite stehen, bedürfte,
um das an sich auch finanziell gesunde, gegebene
Fundament zu einem seiner Tragkraft entspre‐
chenden Aus- und Aufbau zu nutzen. ‒
.Aus allen diesen Erwägungen heraus kann ich
meinem Glückwunsch zur Vollendung des zehn‐
ten Jahrgangs dieser Zeitschrift nur die Form des
Appells an alle, die es angeht, geben, sich selbst
einmal zu überlegen, ob das, was da nun bereits
ein volles Jahrzehnt überdauerte, nicht doch da‐
handelte, die bei allem, was sie erstrebte, das ma‐
teriell Mögliche streng im Auge behalten mußte.
eine Zeitschrift handelt, die einer noch keines‐
wegs konventionell ausgemünzten Form geistiger
Erkenntnisse Ausbreitung zu schaffen sucht, so
daß es überaus schwer hält, die wirklich geeigne‐
ten und allen Einwänden überlegenen Mitarbei‐
ter zu erlangen.
che bewußt, daß der Bezugspreis einer Zeitschrift,
die sich nach Möglichkeit von artfremden Insera‐
ten und Beilagen freihalten soll, kaum die Druck‐
und Versandkosten deckt, so daß es der Beihilfe
vieler, die heute noch lässig, wenn auch wohlmei‐
nend und kritikbereit zur Seite stehen, bedürfte,
um das an sich auch finanziell gesunde, gegebene
Fundament zu einem seiner Tragkraft entspre‐
chenden Aus- und Aufbau zu nutzen. ‒
meinem Glückwunsch zur Vollendung des zehn‐
ten Jahrgangs dieser Zeitschrift nur die Form des
Appells an alle, die es angeht, geben, sich selbst
einmal zu überlegen, ob das, was da nun bereits
ein volles Jahrzehnt überdauerte, nicht doch da‐
mit den Beweis seiner Notwendigkeit erbrachte,
und somit auch den Beweis einer Ausbaufähig‐
keit, die sich nur dann in der Tat bewirken läßt,
wenn gleichstrebende Beihilfe sich dem Heraus‐
geber und Verleger freudig zu verbinden gewillt
ist. ‒
.Geschieht, was Einsicht und Weitblick hier mit
einigem Einsatz der im irdischen Getriebe auch
dem Geistigen nötigen Mittel bewirken können,
so bin ich ganz außer Sorge über die Frage maß‐
geblicher Mitarbeiterschaft, die der «Säule» jenes
Niveau sichern wird, das die näheren Freunde
der Zeitschrift von ihr mit Fug und Recht erwar‐
ten.
.Dann dürfte nach der Vollendung eines weite‐
ren Jahrzehnts wohl kaum noch die Frage erho‐
ben werden können, ob solcher Ausbau vonnöten
war und ob sich der hierfür bereitgestellte Einsatz
lohnte. ‒
.Der Begründer und Herausgeber dieser Zeit‐
schrift wird stets das Verdienst für sich in An‐
spruch nehmen können, ihre Fundamente so tief
verankert zu haben, daß sie auch den hochra‐
gendsten Aufbau zu tragen imstande sein wür‐
den.
und somit auch den Beweis einer Ausbaufähig‐
keit, die sich nur dann in der Tat bewirken läßt,
wenn gleichstrebende Beihilfe sich dem Heraus‐
geber und Verleger freudig zu verbinden gewillt
ist. ‒
einigem Einsatz der im irdischen Getriebe auch
dem Geistigen nötigen Mittel bewirken können,
so bin ich ganz außer Sorge über die Frage maß‐
geblicher Mitarbeiterschaft, die der «Säule» jenes
Niveau sichern wird, das die näheren Freunde
der Zeitschrift von ihr mit Fug und Recht erwar‐
ten.
ren Jahrzehnts wohl kaum noch die Frage erho‐
ben werden können, ob solcher Ausbau vonnöten
war und ob sich der hierfür bereitgestellte Einsatz
lohnte. ‒
schrift wird stets das Verdienst für sich in An‐
spruch nehmen können, ihre Fundamente so tief
verankert zu haben, daß sie auch den hochra‐
gendsten Aufbau zu tragen imstande sein wür‐
den.
ES sind mir zu meinem fünfzigsten Geburtstag
fast unzählige Glückwunschbriefe und Tele‐
gramme ins Haus geflogen, so daß meine anfäng‐
liche Absicht, jedem einzelnen Gratulanten per‐
sönlich zu danken, sich leider als unausführbar er‐
weist, und ich mich in der Zwangslage sehe, we‐
nigstens von den Lesern dieser Zeitschrift die Er‐
leichterung erbitten zu müssen, daß sie mir gütig
erlauben, ihnen auf diese Weise von Herzen Dank
zu sagen. ‒
.Wenn auch der so überreich gefeierte, mit Blu‐
mengrüßen und Geschenken bedachte Tag für
mich nur insofern von besonderer Bedeutung
war, als noch vor kurzer Zeit nicht allzusicher
stand, daß ich ihn in dieser Sichtbarkeit erleben
würde, so waren mir doch diese unerwartet zahl‐
reichen Zeichen der Liebe und Verehrung, die
mir aus aller Welt zugesandt wurden, Anlaß ge‐
rührter Freude und Dankbarkeit genug, um ihn
in frohem Festempfinden und mit heißen Segens‐
fast unzählige Glückwunschbriefe und Tele‐
gramme ins Haus geflogen, so daß meine anfäng‐
liche Absicht, jedem einzelnen Gratulanten per‐
sönlich zu danken, sich leider als unausführbar er‐
weist, und ich mich in der Zwangslage sehe, we‐
nigstens von den Lesern dieser Zeitschrift die Er‐
leichterung erbitten zu müssen, daß sie mir gütig
erlauben, ihnen auf diese Weise von Herzen Dank
zu sagen. ‒
mengrüßen und Geschenken bedachte Tag für
mich nur insofern von besonderer Bedeutung
war, als noch vor kurzer Zeit nicht allzusicher
stand, daß ich ihn in dieser Sichtbarkeit erleben
würde, so waren mir doch diese unerwartet zahl‐
reichen Zeichen der Liebe und Verehrung, die
mir aus aller Welt zugesandt wurden, Anlaß ge‐
rührter Freude und Dankbarkeit genug, um ihn
in frohem Festempfinden und mit heißen Segens‐
wünschen für Alle, die mich liebend zu ehren
suchten, als rechten «Feiertag» zu begehen. ‒ ‒
.Freilich nehme ich die mir entgegengebrachte
Liebe und Ehrung auch gewiß nicht für mich per‐
sönlich in Anspruch, sondern sehe in dem allen
nur die freudige Dankbarkeit der Seelen, die an
Hand der durch meine Bücher der Welt wieder‐
geschenkten Lehren, beglückt zu sich selber fan‐
den, und in sich selbst zu ihrem lebendigen Gott.
.Daß ich noch weiterhin allen zum Lichte Stre‐
benden auf den Weg helfen darf, ist für mich das
schönste Geschenk des Himmels, denn ich weiß
nur zu gut, welche Aufgaben noch darauf warten,
von mir getan zu werden...
.In Zeiten hoher religiöser Kultur ist es verhält‐
nismäßig ein Leichtes, den Weg zum Lichte zu zei‐
gen, da im Vorstellungsleben Aller die grundle‐
genden Voraussetzungen gegeben sind, die zu‐
nächst einmal da sein müssen, soll einige Hoff‐
nung bestehen, daß es gelinge, die Augen der
ernstlich Suchenden zu öffnen.
.Heute aber gilt es vor allem, erst einmal diese
Voraussetzungen wieder zu schaffen, und der Weg,
der gezeigt werden soll, ist überdies derart von
dürrem und grünem Gestrüpp überwuchert, daß
es vonnöten ist, ihn erst wieder zu bahnen und al‐
suchten, als rechten «Feiertag» zu begehen. ‒ ‒
Liebe und Ehrung auch gewiß nicht für mich per‐
sönlich in Anspruch, sondern sehe in dem allen
nur die freudige Dankbarkeit der Seelen, die an
Hand der durch meine Bücher der Welt wieder‐
geschenkten Lehren, beglückt zu sich selber fan‐
den, und in sich selbst zu ihrem lebendigen Gott.
benden auf den Weg helfen darf, ist für mich das
schönste Geschenk des Himmels, denn ich weiß
nur zu gut, welche Aufgaben noch darauf warten,
von mir getan zu werden...
nismäßig ein Leichtes, den Weg zum Lichte zu zei‐
gen, da im Vorstellungsleben Aller die grundle‐
genden Voraussetzungen gegeben sind, die zu‐
nächst einmal da sein müssen, soll einige Hoff‐
nung bestehen, daß es gelinge, die Augen der
ernstlich Suchenden zu öffnen.
Voraussetzungen wieder zu schaffen, und der Weg,
der gezeigt werden soll, ist überdies derart von
dürrem und grünem Gestrüpp überwuchert, daß
es vonnöten ist, ihn erst wieder zu bahnen und al‐
lenthalben neue Wegmarken zu setzen, damit der
Suchende vor den verderblichsten Irrgängen be‐
wahrt werde. ‒
.So sehe ich denn bis heute noch kaum das Allernö‐
tigste getan, wenn meine Lebensaufgabe wirklich
erfüllt werden soll, und mehr denn je bin ich mir
heute der Tatsache bewußt, daß mein Wirken
durchaus nicht außerhalb der Gesetze steht, die
jegliches menschliche Schaffen bestimmen, so
daß auch in meinem Verkündungswerke ohne
Zweifel die Linie einer allmählichen Entfaltung
einst feststellbar sein wird, sei es auch nur im Hin‐
blick auf die Fähigkeit, das oft fast Unsagbare in
Worten menschlicher Sprache zum Ausdruck zu
bringen...
.Aus innerster Gewißheit kann ich sagen, daß
ich wohl auch nach weiteren fünfzig Jahren, wenn
solches im Bereich der mir bestimmten irdischen
Lebensbahn gegeben wäre, mich noch in gleicher
Weise erst am Beginn meines Wirkens fühlen
würde, denn keine Kunst der Sprache ist jemals
vollendet genug, um dessen wahrhaft würdig zu
werden, was ich meinen Mitmenschen hier auf
Erden zu Bewußtsein bringen soll! ‒ ‒
.In solcher Erkenntnis weiterwirkend, danke
ich allen, die den «Weg» betreten haben, daß sie
Suchende vor den verderblichsten Irrgängen be‐
wahrt werde. ‒
tigste getan, wenn meine Lebensaufgabe wirklich
erfüllt werden soll, und mehr denn je bin ich mir
heute der Tatsache bewußt, daß mein Wirken
durchaus nicht außerhalb der Gesetze steht, die
jegliches menschliche Schaffen bestimmen, so
daß auch in meinem Verkündungswerke ohne
Zweifel die Linie einer allmählichen Entfaltung
einst feststellbar sein wird, sei es auch nur im Hin‐
blick auf die Fähigkeit, das oft fast Unsagbare in
Worten menschlicher Sprache zum Ausdruck zu
bringen...
ich wohl auch nach weiteren fünfzig Jahren, wenn
solches im Bereich der mir bestimmten irdischen
Lebensbahn gegeben wäre, mich noch in gleicher
Weise erst am Beginn meines Wirkens fühlen
würde, denn keine Kunst der Sprache ist jemals
vollendet genug, um dessen wahrhaft würdig zu
werden, was ich meinen Mitmenschen hier auf
Erden zu Bewußtsein bringen soll! ‒ ‒
ich allen, die den «Weg» betreten haben, daß sie
nicht Anstoß nahmen an dem, was etwa Mangel
menschlichen Ausdrucksvermögens nicht zu faß‐
lichster Verständlichkeit kommen ließ, und sich
an das unmißdeutbar Gegebene hielten, das in ih‐
rem eigenen Herzen Widerhall fand, um so zur
Gewißheit auch dessen zu gelangen, was meine
Worte noch im Dunkel lassen mußten! ‒
.Möge es mir beschieden sein, den Pfad immer
mehr erhellen zu dürfen, zum Besten derer, die
ihn bereits betreten haben, wie nicht minder aller
jener, die ihn, durch meine Worte bewegt, zu‐
künftig in sich suchen wollen! ‒
.Die frohe Hoffnung, für Gegenwart und alle
Zukunft Weg und Ziel stets lichter und klarer be‐
zeichnen zu können, und damit die Zahl der Men‐
schen zu vermehren, die schon hier auf Erden
zum untrüglichen Bewußtsein ihres ewigen Le‐
bens gelangen, läßt mir vor allem anderen mein
weiteres Erdendasein, dem es an Mühe, Arbeit
und Sorge wahrlich noch niemals fehlte, als aller
mir so liebevoll zugedachten Wünsche wert er‐
scheinen! ‒ ‒
menschlichen Ausdrucksvermögens nicht zu faß‐
lichster Verständlichkeit kommen ließ, und sich
an das unmißdeutbar Gegebene hielten, das in ih‐
rem eigenen Herzen Widerhall fand, um so zur
Gewißheit auch dessen zu gelangen, was meine
Worte noch im Dunkel lassen mußten! ‒
mehr erhellen zu dürfen, zum Besten derer, die
ihn bereits betreten haben, wie nicht minder aller
jener, die ihn, durch meine Worte bewegt, zu‐
künftig in sich suchen wollen! ‒
Zukunft Weg und Ziel stets lichter und klarer be‐
zeichnen zu können, und damit die Zahl der Men‐
schen zu vermehren, die schon hier auf Erden
zum untrüglichen Bewußtsein ihres ewigen Le‐
bens gelangen, läßt mir vor allem anderen mein
weiteres Erdendasein, dem es an Mühe, Arbeit
und Sorge wahrlich noch niemals fehlte, als aller
mir so liebevoll zugedachten Wünsche wert er‐
scheinen! ‒ ‒
Im Dezember, 1926
ES ist gewiß nicht die Schuld der Schriftleitung
dieser Zeitschrift*, wenn meine Worte des
Dankes erst so spät all jenen Lesern vermittelt
werden, die mir bei Gelegenheit meines fünfzig‐
sten Geburtstages liebe Grüße und Glückwünsche
sandten.
.Äußere Umstände verschiedener Art ließen
mich nicht eher dazu kommen, das hier Gesagte
niederzuschreiben, und diese Verzögerung war
mitbedingt durch meine anfängliche Absicht, den
einzelnen Gratulanten, wenn irgend möglich,
brieflich zu danken oder danken zu lassen.
.Leider wurde das zu einem Ding der Unmög‐
lichkeit.
.So hoffe ich denn, daß mein verspäteter Dank
wohl doch auch jetzt noch entgegengenommen
werden mag, und daß man es mir nicht verübelt,
dieser Zeitschrift*, wenn meine Worte des
Dankes erst so spät all jenen Lesern vermittelt
werden, die mir bei Gelegenheit meines fünfzig‐
sten Geburtstages liebe Grüße und Glückwünsche
sandten.
mich nicht eher dazu kommen, das hier Gesagte
niederzuschreiben, und diese Verzögerung war
mitbedingt durch meine anfängliche Absicht, den
einzelnen Gratulanten, wenn irgend möglich,
brieflich zu danken oder danken zu lassen.
lichkeit.
wohl doch auch jetzt noch entgegengenommen
werden mag, und daß man es mir nicht verübelt,
*«Magnum Opus», Freiburg i.Br.
wenn ich ihn nur auf diese Weise zum Ausdruck
bringen kann.
.Wenn ich auch selbst sehr wenig Wert auf die
Wiederkehr der Daten des Kalenders lege, so war
es mir doch wahrhaft wohltuend und beglückend,
von so vielen zum Lichte Strebenden aus aller
Welt die rührendsten Zeichen der Verehrung
und Liebe zu empfangen.
.Ich bin dabei sehr weit davon entfernt, diese
Bekundungen der Dankbarkeit etwa auf mich
persönlich zu beziehen, und es wurde mir vielmehr
Anlaß besonderer Vertiefung meiner Freude, al‐
les, was man mir zu sagen kam, geistig an der
Quelle niederlegen zu können, aus der die Lehre
entströmt, der ich den Weg zu den Herzen zu be‐
reiten suche...
.Aus den allermeisten Zuschriften war denn
auch wirklich bereits zu ersehen, daß die mich Be‐
grüßenden im Innersten erfühlt oder erahnt ha‐
ben, um was es sich in meinem Wirken handelt
und allein handeln kann, und wenn andere auch
noch erkennen ließen, daß ihnen noch nicht recht
zu Bewußtsein kam, wie weit entfernt die Offen‐
barung des Urlichtes, die allein ich der Welt zu
vermitteln habe, aller spekulativ erdachten Er‐
denweisheit ist ‒ wenn auch einige gar mir dan‐
bringen kann.
Wiederkehr der Daten des Kalenders lege, so war
es mir doch wahrhaft wohltuend und beglückend,
von so vielen zum Lichte Strebenden aus aller
Welt die rührendsten Zeichen der Verehrung
und Liebe zu empfangen.
Bekundungen der Dankbarkeit etwa auf mich
persönlich zu beziehen, und es wurde mir vielmehr
Anlaß besonderer Vertiefung meiner Freude, al‐
les, was man mir zu sagen kam, geistig an der
Quelle niederlegen zu können, aus der die Lehre
entströmt, der ich den Weg zu den Herzen zu be‐
reiten suche...
auch wirklich bereits zu ersehen, daß die mich Be‐
grüßenden im Innersten erfühlt oder erahnt ha‐
ben, um was es sich in meinem Wirken handelt
und allein handeln kann, und wenn andere auch
noch erkennen ließen, daß ihnen noch nicht recht
zu Bewußtsein kam, wie weit entfernt die Offen‐
barung des Urlichtes, die allein ich der Welt zu
vermitteln habe, aller spekulativ erdachten Er‐
denweisheit ist ‒ wenn auch einige gar mir dan‐
ken zu müssen glaubten für meine «tiefschürfen‐
den Gedanken» oder meine «lebensbejahende
Philosophie», so war doch auch das herzlich gut
gemeint, und ich zweifle kaum daran, daß auch
diesen noch mehr außen Stehenden im Verlaufe
der Zeit ein tieferes Eindringen möglich werden
wird, wie es die Erkenntnis der ewig unwandelba‐
ren Wahrheit nun einmal fordert.
.Wenn man mir Gutes wünscht für mein weite‐
res äußeres Erdendasein, so sehe ich das mir wün‐
schenswerteste Gute vor allem darin, daß es die
hohen Geistesmächte, denen ich alles danke, also
lenken möchten, daß auch jene Suchenden, die
jetzt noch fernab stehen und im Dunkeln tasten,
dereinst zu glückbewegten Findern werden.
.Der Weg zum Lichte ist wahrlich durch meine
Lehre schon aufs deutlichste gezeigt und all mein
Wirken kann jetzt nur noch dazu dienen, ihn im‐
mer aufs neue auch denen zu zeigen, die noch in
der Wildnis irren, oder ihn zu finden meinen, wo
er nicht zu finden ist.
.Wohl weiß ich, was noch vor mir liegt, wenn ich
im Laufe der Jahre allem noch Ausdruck schaffen
soll, was denen helfen kann, die redlichen Her‐
zens nach dem Licht der Ewigkeit verlangen ‒
wenn ich alle erreichen will, die noch befangen
sind im Wahn: als handle es sich hier um etwas,
den Gedanken» oder meine «lebensbejahende
Philosophie», so war doch auch das herzlich gut
gemeint, und ich zweifle kaum daran, daß auch
diesen noch mehr außen Stehenden im Verlaufe
der Zeit ein tieferes Eindringen möglich werden
wird, wie es die Erkenntnis der ewig unwandelba‐
ren Wahrheit nun einmal fordert.
res äußeres Erdendasein, so sehe ich das mir wün‐
schenswerteste Gute vor allem darin, daß es die
hohen Geistesmächte, denen ich alles danke, also
lenken möchten, daß auch jene Suchenden, die
jetzt noch fernab stehen und im Dunkeln tasten,
dereinst zu glückbewegten Findern werden.
Lehre schon aufs deutlichste gezeigt und all mein
Wirken kann jetzt nur noch dazu dienen, ihn im‐
mer aufs neue auch denen zu zeigen, die noch in
der Wildnis irren, oder ihn zu finden meinen, wo
er nicht zu finden ist.
im Laufe der Jahre allem noch Ausdruck schaffen
soll, was denen helfen kann, die redlichen Her‐
zens nach dem Licht der Ewigkeit verlangen ‒
wenn ich alle erreichen will, die noch befangen
sind im Wahn: als handle es sich hier um etwas,
das der Strebende erlangen könne, wenn er sich
im Denken dazu aufzuschwingen wisse...
.Nur die wenigsten ahnen allbereits, daß die Be‐
friedigung, die uns gedankliches Erschließen
bringen kann, zwar recht erfreulich sein mag,
aber keineswegs auch nur das mindeste uns nützt,
wenn dieser Erdenleib dereinst verlassen werden
muß. ‒ ‒ ‒
.So rede ich denn vielen noch wie in einer ihnen
fremden Sprache, weil sie gewohnheitsmäßig
meine Worte bildlich nehmen, dort wo ich vom
Geiste als von jener höchsten Wirklichkeit zu
sprechen habe, die allem Denken unvergleichbar ist.
.Von Schein und Scheinweisheit geblendete Au‐
gen gilt es vor allem erst zu heilen, und leider weiß
ich, daß Jahrtausende vergehen werden, ehe wie‐
der einer kommen wird, der hier Arzt sein kann,
wenn es auch niemals an Quacksalbern und un‐
berufenen, eigenmächtigen Kurpfuschern fehlen
wird, und ebensowenig an solchen Menschen, die
das Heil stets nur dort erwarten, wo es niemals zu er‐
langen ist. ‒
.So danke ich denn allen, die mir segensreiches
weiteres Wirken wünschten, insonderheit auch
im Namen derer, denen mein Wirken noch gar
sehr vonnöten ist! ‒
im Denken dazu aufzuschwingen wisse...
friedigung, die uns gedankliches Erschließen
bringen kann, zwar recht erfreulich sein mag,
aber keineswegs auch nur das mindeste uns nützt,
wenn dieser Erdenleib dereinst verlassen werden
muß. ‒ ‒ ‒
fremden Sprache, weil sie gewohnheitsmäßig
meine Worte bildlich nehmen, dort wo ich vom
Geiste als von jener höchsten Wirklichkeit zu
sprechen habe, die allem Denken unvergleichbar ist.
gen gilt es vor allem erst zu heilen, und leider weiß
ich, daß Jahrtausende vergehen werden, ehe wie‐
der einer kommen wird, der hier Arzt sein kann,
wenn es auch niemals an Quacksalbern und un‐
berufenen, eigenmächtigen Kurpfuschern fehlen
wird, und ebensowenig an solchen Menschen, die
das Heil stets nur dort erwarten, wo es niemals zu er‐
langen ist. ‒
weiteres Wirken wünschten, insonderheit auch
im Namen derer, denen mein Wirken noch gar
sehr vonnöten ist! ‒
Im Januar 1927
DIE in den Ländern des Sonnenaufgangs gel‐
tende Gepflogenheit, am Geburtstag eines
Menschen lediglich seiner Mutter zu gedenken, da
er ja bei dem Ereignis seiner Geburt nur passiv be‐
teiligt war, entspricht durchaus meinem eigenen
Empfinden, so daß ich nach allen in Betracht
kommenden Seiten hin eindringlich den Wunsch
geäußert hatte, man möge von der platten Tatsa‐
che, daß sich zum sechzigsten Male die jährliche
Wiederkehr des Datums meines Eintretens in die‐
ses Erdendasein ereigne, keinerlei Notiz nehmen.
.Nun ist jedoch trotzdem an diesem Tage eine
derartige Menge von Gratulationen bei mir ein‐
gelaufen, daß ich mich vor die Frage gestellt sehe,
ob meine Auffassung nicht, etwas zu einseitig, von
anderen eine Zurückhaltung erwartet habe, wo
mit Freuden die Gelegenheit erwünscht worden
war, einem vielfach empfundenen seelischen
Drängen Ausdruck geben zu dürfen.
.Ich mag auch nicht verschweigen, daß ich mich
nun dennoch mit jeder, auch der bescheidensten
tende Gepflogenheit, am Geburtstag eines
Menschen lediglich seiner Mutter zu gedenken, da
er ja bei dem Ereignis seiner Geburt nur passiv be‐
teiligt war, entspricht durchaus meinem eigenen
Empfinden, so daß ich nach allen in Betracht
kommenden Seiten hin eindringlich den Wunsch
geäußert hatte, man möge von der platten Tatsa‐
che, daß sich zum sechzigsten Male die jährliche
Wiederkehr des Datums meines Eintretens in die‐
ses Erdendasein ereigne, keinerlei Notiz nehmen.
derartige Menge von Gratulationen bei mir ein‐
gelaufen, daß ich mich vor die Frage gestellt sehe,
ob meine Auffassung nicht, etwas zu einseitig, von
anderen eine Zurückhaltung erwartet habe, wo
mit Freuden die Gelegenheit erwünscht worden
war, einem vielfach empfundenen seelischen
Drängen Ausdruck geben zu dürfen.
nun dennoch mit jeder, auch der bescheidensten
Gratulation gefreut habe, wenn ich auch nur den
allergeringsten Teil von dem mir Zugedachten
am gemeinten Tage selbst einzusehen vermochte.
.Was mich aber jetzt, nachdem ich endlich alles
gelesen habe, am allermeisten freut, ist die in so
vielen kurzen und längeren Briefen zu findende,
fast wörtliche Wiederkehr des Satzes: «Was wäre
aus mir geworden, hätte mir e. unsichtbare Führung
nicht vor Jahren Ihre Bücher zugeleitet, die mir nun si‐
chere Wegweiser auch in allen Angelegenheiten d. äus‐
seren Alltagslebens geworden sind, so daß ich sie nie
mehr missen möchte!»
.Ich muß unumwunden sagen, daß mir diese,
nur auf die Werte praktischer irdischer Lebens‐
gestaltung bezogenen Dankesbekenntnisse fast
noch mehr Freude bereitet haben, als die vielen,
mir gewiß überaus erfreulichen Beweise der seeli‐
schen Einfühlung in die von mir so vielgestaltig
dargebotenen Schilderungen der inneren Struk‐
tur des ewigen Geisteslebens, das unser aller Da‐
seinsgrund ist, denn die vom Innersten der Seele
her gesicherte Aufnahme ewig unwandelbarer
Geisteswirklichkeit sollte ja jedem meiner Mit‐
menschen, der über ein gesundes Empfindungs‐
vermögen und klares Denken verfügt, ganz
selbstverständliches Ergebnis der Beschäftigung
mit meinem nun abgeschlossenen Lehrwerk sein,
allergeringsten Teil von dem mir Zugedachten
am gemeinten Tage selbst einzusehen vermochte.
gelesen habe, am allermeisten freut, ist die in so
vielen kurzen und längeren Briefen zu findende,
fast wörtliche Wiederkehr des Satzes: «Was wäre
aus mir geworden, hätte mir e. unsichtbare Führung
nicht vor Jahren Ihre Bücher zugeleitet, die mir nun si‐
chere Wegweiser auch in allen Angelegenheiten d. äus‐
seren Alltagslebens geworden sind, so daß ich sie nie
mehr missen möchte!»
nur auf die Werte praktischer irdischer Lebens‐
gestaltung bezogenen Dankesbekenntnisse fast
noch mehr Freude bereitet haben, als die vielen,
mir gewiß überaus erfreulichen Beweise der seeli‐
schen Einfühlung in die von mir so vielgestaltig
dargebotenen Schilderungen der inneren Struk‐
tur des ewigen Geisteslebens, das unser aller Da‐
seinsgrund ist, denn die vom Innersten der Seele
her gesicherte Aufnahme ewig unwandelbarer
Geisteswirklichkeit sollte ja jedem meiner Mit‐
menschen, der über ein gesundes Empfindungs‐
vermögen und klares Denken verfügt, ganz
selbstverständliches Ergebnis der Beschäftigung
mit meinem nun abgeschlossenen Lehrwerk sein,
während das Hereinwirken ins praktische, durch
so mancherlei äußere Umstände gemeinsam be‐
stimmte Alltagsleben mit seinen notwendigen An‐
forderungen, schon «die Probe aufs Exempel»
darstellt.
.Aber alle Gratulanten ‒ ohne jegliche Aus‐
nahme ‒ soweit sie durch diese Zeitschrift erreich‐
bar sind, dürfen gewiß sein, daß sie mir mit ihrem
Gedenken Freude bereitet haben. Allen sei hier‐
mit von Herzen gedankt!
.Mit allen Segenswünschen für jeden der überaus
Vielen, denen ich auf keine andere Weise im ein‐
zelnen antworten kann.
so mancherlei äußere Umstände gemeinsam be‐
stimmte Alltagsleben mit seinen notwendigen An‐
forderungen, schon «die Probe aufs Exempel»
darstellt.
nahme ‒ soweit sie durch diese Zeitschrift erreich‐
bar sind, dürfen gewiß sein, daß sie mir mit ihrem
Gedenken Freude bereitet haben. Allen sei hier‐
mit von Herzen gedankt!
Vielen, denen ich auf keine andere Weise im ein‐
zelnen antworten kann.
Im November 1936
DIE Menschen, denen ich das Leben danke,
waren einfache Leute, aber beider Familien
standen in ihrem Kreise in hohem Ansehen, das
durch Besitz, Tüchtigkeit und persönliche
Würde, mehr aber noch durch Rechtlichkeit und
Wohltätigkeit begründet war.
.Frömmigkeit, in den Formen der Kirche Roms,
war erblich.
.Mein Vater, ein strenger Mann, dem alles
Menschliche Sünde war, ist niemals lachend gese‐
hen worden.
.Meine Mutter, eine tiefreligiöse Frau, voll ech‐
ter Mystik, lebte in ständiger Gemeinschaft mit
den heiligen Wesen, die sie nach katholischer
Lehre verehrte, und ihre Andacht war mehr ein
Schauen als bloßer Glaube.
.Ich war etwa 7 Jahre und einige Tage alt, als zum
erstenmal ein Bote jener Gemeinschaft, deren
Bruder ich heute bin, sichtbar in mein Leben trat. ‒
waren einfache Leute, aber beider Familien
standen in ihrem Kreise in hohem Ansehen, das
durch Besitz, Tüchtigkeit und persönliche
Würde, mehr aber noch durch Rechtlichkeit und
Wohltätigkeit begründet war.
war erblich.
Menschliche Sünde war, ist niemals lachend gese‐
hen worden.
ter Mystik, lebte in ständiger Gemeinschaft mit
den heiligen Wesen, die sie nach katholischer
Lehre verehrte, und ihre Andacht war mehr ein
Schauen als bloßer Glaube.
erstenmal ein Bote jener Gemeinschaft, deren
Bruder ich heute bin, sichtbar in mein Leben trat. ‒
.An einem strahlend schönen Sonntag-Morgen
lag ich, erfrischt durch einen gesunden Kinder‐
schlaf, bereits völlig erwacht in meinem kleinen
Bette.
.Die Sonne schien durch das geöffnete Fenster
und erfüllte den ganzen Raum mit Licht.
.Die Mutter war zur «Frühmesse» gegangen,
während wohl der Vater, wie es seine Gewohnheit
auch später war, in dem alten Predigtbuch, dem
Geschenk eines verstorbenen geistlichen Freun‐
des, die auf den Sonntag gerade bezügliche Pre‐
digt las.
.Ich hatte nur die Mutter gesehen, bevor sie zur
Kirche ging.
.Während ich nun so lag, in froher Erwartung
der Rückkehr der Mutter, ‒ plötzlich, ohne daß
eine Türe sich geöffnet hätte, stand zu Füßen mei‐
nes Bettes ein alter Mann im Sonnenschein, ange‐
tan mit seltsamen und mir recht ärmlich erschei‐
nenden dicken Wintergewändern. (Heute weiß
ich, daß es die im Innern Hochasiens übliche
Wintertracht war).
.Ich sah sein braunes durchfurchtes Gesicht und
glaubte zuerst, es sei ein alter Bettler, der öfter ins
Haus kam um ein Essen zu erhalten.
lag ich, erfrischt durch einen gesunden Kinder‐
schlaf, bereits völlig erwacht in meinem kleinen
Bette.
und erfüllte den ganzen Raum mit Licht.
während wohl der Vater, wie es seine Gewohnheit
auch später war, in dem alten Predigtbuch, dem
Geschenk eines verstorbenen geistlichen Freun‐
des, die auf den Sonntag gerade bezügliche Pre‐
digt las.
Kirche ging.
der Rückkehr der Mutter, ‒ plötzlich, ohne daß
eine Türe sich geöffnet hätte, stand zu Füßen mei‐
nes Bettes ein alter Mann im Sonnenschein, ange‐
tan mit seltsamen und mir recht ärmlich erschei‐
nenden dicken Wintergewändern. (Heute weiß
ich, daß es die im Innern Hochasiens übliche
Wintertracht war).
glaubte zuerst, es sei ein alter Bettler, der öfter ins
Haus kam um ein Essen zu erhalten.
.Erschreckt schrie ich auf.
.Der Vater, seit Jahren sehr schwerhörig,
konnte mich nicht vernehmen. Die Gestalt jedoch
kehrte sich nicht an meinen Angstschrei und der
Gesichtsausdruck des alten Mannes hatte etwas so
unbeschreiblich Gütiges, daß ich sogleich darauf
mich völlig sicher fühlte.
.Ich «wußte», daß er irgend etwas Gutes für
mich hier zu tun habe, ohne mir Rechenschaft zu
geben darüber, was das wohl wäre. ‒
.Mit einem Gefühl der Neugierde und des Ver‐
trauens zugleich betrachtete ich bald das faltige,
und so unendlich gütige Gesicht, bald den seltsa‐
men Mantel, der mir besonders merkwürdig war,
weil die Ärmel viel zu lang und weit über die
Hände herabreichten. Bilder, auf denen so etwas
dargestellt gewesen wäre, hatte ich niemals gese‐
hen.
.Da hob er langsam und bedächtig den Arm,
streifte den überlangen Ärmel zurück, und kam
zur Seite meines Bettes.
.Ich war so unerklärlich vertrauensvoll, daß ich
es diesmal, ohne zu schreien und ganz von Angst
befreit, geschehen ließ, daß er mit der rechten
Hand, einer Hand mit vornehmen feinen Fin‐
konnte mich nicht vernehmen. Die Gestalt jedoch
kehrte sich nicht an meinen Angstschrei und der
Gesichtsausdruck des alten Mannes hatte etwas so
unbeschreiblich Gütiges, daß ich sogleich darauf
mich völlig sicher fühlte.
mich hier zu tun habe, ohne mir Rechenschaft zu
geben darüber, was das wohl wäre. ‒
trauens zugleich betrachtete ich bald das faltige,
und so unendlich gütige Gesicht, bald den seltsa‐
men Mantel, der mir besonders merkwürdig war,
weil die Ärmel viel zu lang und weit über die
Hände herabreichten. Bilder, auf denen so etwas
dargestellt gewesen wäre, hatte ich niemals gese‐
hen.
streifte den überlangen Ärmel zurück, und kam
zur Seite meines Bettes.
es diesmal, ohne zu schreien und ganz von Angst
befreit, geschehen ließ, daß er mit der rechten
Hand, einer Hand mit vornehmen feinen Fin‐
gern, langsam über meine Decke strich. Dabei
verweilte er Augenblicke über meinen Füßen,
über den Knien, dann über dem Herzen und zu‐
letzt legte er die feine zarte Hand auf meine
Stirne.
.Dabei schlief ich ein. ‒ ‒
.Ich erwachte erst, als längst die Mutter von der
Kirche zurückgekommen war.
.«Wo ist der Mann? ‒ Wer war denn der Mann? ‒
Er muß ja noch hier sein. ‒ Du weißt gewiß wer er
ist.» ‒
.So bestürmte ich meine Mutter mit Fragen, die
sie ängstlich bestürzt anhörte.
.Nachdem auch der Vater meine Worte gehört
hatte, wurde zu meinem größten Leidwesen ent‐
schieden, ich dürfe heute nicht mit zum Hoch‐
Amt, sondern müsse mich ausschlafen.
.Nach dem Frühstück wurde das Zimmer ver‐
dunkelt, alles Protestieren half nichts, und ich
mußte «schlafen».
.Ich schlief aber nicht. ‒
.Stets suchten meine Augen den alten Mann, je‐
doch er kam nicht wieder.
verweilte er Augenblicke über meinen Füßen,
über den Knien, dann über dem Herzen und zu‐
letzt legte er die feine zarte Hand auf meine
Stirne.
Kirche zurückgekommen war.
Er muß ja noch hier sein. ‒ Du weißt gewiß wer er
ist.» ‒
sie ängstlich bestürzt anhörte.
hatte, wurde zu meinem größten Leidwesen ent‐
schieden, ich dürfe heute nicht mit zum Hoch‐
Amt, sondern müsse mich ausschlafen.
dunkelt, alles Protestieren half nichts, und ich
mußte «schlafen».
doch er kam nicht wieder.
.Dabei hatte ich eine brennende Sehnsucht nach
ihm und versprach mir hoch und heilig, daß ich,
wenn er wiederkäme, gewiß nicht mehr schreien
würde. Er kam nicht, aber alles im Zimmer schien
mir lebendig geworden.
.Ich fühlte mich, wie wenn eine ganze Gesell‐
schaft guter Leute um mich wäre. Dabei war mir
leicht und so froh zumute, daß ich schließlich die
Betthaft nicht mehr aushielt und unversehens,
gewaschen und angezogen, neben der Mutter in
der Küche stand. Sie mochte wohl sehen, daß mir
nichts fehlte und so wurde mir erlaubt, hinab zum
Garten zu gehen, wo ich noch den ganzen Mor‐
gen hinter jedem Busch und wo es nur ein Ver‐
steck gab, nach dem alten Manne suchte.
.Alle Gärtnerburschen wurden befragt nach ihm
und kein Auslachen konnte mich irre machen.
.Ich wurde älter.
.Das religiöse Leben, in der Art wie meine Mut‐
ter es pflegte und es mir nahelegte, übte große
Anziehungskraft auf mich aus.
.Im übrigen war ich ein völlig normaler Junge,
mit allen guten und üblen Eigenschaften.
ihm und versprach mir hoch und heilig, daß ich,
wenn er wiederkäme, gewiß nicht mehr schreien
würde. Er kam nicht, aber alles im Zimmer schien
mir lebendig geworden.
schaft guter Leute um mich wäre. Dabei war mir
leicht und so froh zumute, daß ich schließlich die
Betthaft nicht mehr aushielt und unversehens,
gewaschen und angezogen, neben der Mutter in
der Küche stand. Sie mochte wohl sehen, daß mir
nichts fehlte und so wurde mir erlaubt, hinab zum
Garten zu gehen, wo ich noch den ganzen Mor‐
gen hinter jedem Busch und wo es nur ein Ver‐
steck gab, nach dem alten Manne suchte.
und kein Auslachen konnte mich irre machen.
ter es pflegte und es mir nahelegte, übte große
Anziehungskraft auf mich aus.
mit allen guten und üblen Eigenschaften.
.Tollkühn und waghalsig trieb ich mich viel im
Freien, im Wald und Feld herum, und lebte des
Glaubens, daß mir nie etwas geschehen könne.
Kein Baum war zu hoch, kein Abhang zu steil zum
Erklettern, kein Mensch und kein Tier wurde ge‐
fürchtet. Im religiösen Leben aber war der ganze
Junge ein Anderer.
.Alle die Worte der Liturgie, alle Symbole des
Ritus wurden von mir mit einer tiefen klaren Be‐
deutung erfüllt und es wurden mir in dieser
Weise Dinge klar, über die ich gelegentlich von
Erwachsenen als von «unerklärlichen Rätseln»
sprechen hörte.
.Ich fürchtete mich, etwas von dem zu verraten,
was ich «wußte», denn es war so ganz anders als
die Erklärungen der Predigt, oder die des Kate‐
chismus. Nicht im geringsten aber konnten mich
diese anderen Meinungen irre machen an dem,
was ich auf diese innere klare Weise schaute. So
ging es lange Jahre, bis im halbwegs Erwachsenen
die äußeren Zweifel an Kirche und kirchliche
Lehre erwachten.
.Da fielen wohl manche Formen, aber für jede
«Form» war schon ein tieferer «Inhalt» in mir le‐
bendig. Der «alte Mann» war fast vergessen, je‐
doch an seiner Stelle stand etwas, das immer,
Freien, im Wald und Feld herum, und lebte des
Glaubens, daß mir nie etwas geschehen könne.
Kein Baum war zu hoch, kein Abhang zu steil zum
Erklettern, kein Mensch und kein Tier wurde ge‐
fürchtet. Im religiösen Leben aber war der ganze
Junge ein Anderer.
Ritus wurden von mir mit einer tiefen klaren Be‐
deutung erfüllt und es wurden mir in dieser
Weise Dinge klar, über die ich gelegentlich von
Erwachsenen als von «unerklärlichen Rätseln»
sprechen hörte.
was ich «wußte», denn es war so ganz anders als
die Erklärungen der Predigt, oder die des Kate‐
chismus. Nicht im geringsten aber konnten mich
diese anderen Meinungen irre machen an dem,
was ich auf diese innere klare Weise schaute. So
ging es lange Jahre, bis im halbwegs Erwachsenen
die äußeren Zweifel an Kirche und kirchliche
Lehre erwachten.
«Form» war schon ein tieferer «Inhalt» in mir le‐
bendig. Der «alte Mann» war fast vergessen, je‐
doch an seiner Stelle stand etwas, das immer,
selbst in den tollsten Stunden, um mich war und
das mich nur deshalb an ihn denken ließ, weil es
mit demselben Gefühl der Zuversicht auf meine
Seele wirkte, wie dieser seltsame Alte mit seinem
wohltätigen Streichen der Hand, mit seinem so
unendlich gütigen Ausdruck. ‒
.Mir war oft ein innerlicher Zuspruch gewor‐
den, zu Zeiten, in denen ich gerade am wenigsten
dessen würdig schien, und jedesmal hatte ich stär‐
ker als sonst das Gefühl des Zusammenhanges mit
jenem alten Mann, und ich war in solchen Mo‐
menten fester überzeugt als je, daß ich ihn wie‐
dersehen würde. ‒
.Mittlerweile hatte ich mich einem Lebensberuf
gewidmet. In dieser Zeit kam ich mit Spiritisten in
Berührung, und deren Sache erschien mir mehr
als nur interessant.
.Ich hatte Gelegenheit, unter den denkbar si‐
chersten Bedingungen, die unglaublichsten Phä‐
nomene zu sehen, aber meine geheime Hoff‐
nung, gelegentlich auf diese Art jenes Alten wie‐
der ansichtig zu werden, wurde nicht erfüllt. Ich
fühlte im Gegenteil eine immer mehr sich aus‐
breitende Kälte und Leere in mir, je mehr ich
mich an den «Sitzungen» beteiligt hatte. Der in‐
nere Zuspruch, an den ich fast gewohnt war, hatte
das mich nur deshalb an ihn denken ließ, weil es
mit demselben Gefühl der Zuversicht auf meine
Seele wirkte, wie dieser seltsame Alte mit seinem
wohltätigen Streichen der Hand, mit seinem so
unendlich gütigen Ausdruck. ‒
den, zu Zeiten, in denen ich gerade am wenigsten
dessen würdig schien, und jedesmal hatte ich stär‐
ker als sonst das Gefühl des Zusammenhanges mit
jenem alten Mann, und ich war in solchen Mo‐
menten fester überzeugt als je, daß ich ihn wie‐
dersehen würde. ‒
gewidmet. In dieser Zeit kam ich mit Spiritisten in
Berührung, und deren Sache erschien mir mehr
als nur interessant.
chersten Bedingungen, die unglaublichsten Phä‐
nomene zu sehen, aber meine geheime Hoff‐
nung, gelegentlich auf diese Art jenes Alten wie‐
der ansichtig zu werden, wurde nicht erfüllt. Ich
fühlte im Gegenteil eine immer mehr sich aus‐
breitende Kälte und Leere in mir, je mehr ich
mich an den «Sitzungen» beteiligt hatte. Der in‐
nere Zuspruch, an den ich fast gewohnt war, hatte
nach und nach gänzlich aufgehört, und dennoch
verließ mich nicht jenes unerklärliche Gefühl, in
Sicherheit und guter Hut zu sein.
.An einem Weihnachtsfest endlich vernahm ich
wieder das Gewohnte, und diesmal war es eine so
starke Warnung vor den Experimenten, denen
ich als Zuschauer beigewohnt hatte, daß ich, zum
Erstaunen der früheren Freunde, plötzlich die
Beziehungen zu jenen Spiritisten abbrach.
.Ich empfand ein Grauen vor dieser Sache, als
ob ich verwesende Leichname liebkost hätte, und
nichts in der Welt hätte mich je wieder zu den Sit‐
zungen bewegen können.
.Immerhin waren mir in dieser Zeit einige Be‐
griffe klarer geworden, zu denen mir «Thomas a
Kempis», mein einziges mystisches Lehrbuch,
noch nicht die nötige Aufklärung gab.
.(Daß das römisch-katholische Meßbuch das
vollkommenste Einweihungs-Rituale der Welt
darstellt, wußte ich damals noch nicht, trotzdem
ich an seiner Hand in die tiefsten Mysterien nach
und nach geistig eingeführt wurde. ‒
.Wie oft mußte ich später an jenes Wort Jesu
denken: «Ihr habt die Schlüssel des Himmel‐
reichs, aber Ihr gehet nicht hinein, und denen,
die hineinwollen, wehret ihr!») ‒
verließ mich nicht jenes unerklärliche Gefühl, in
Sicherheit und guter Hut zu sein.
wieder das Gewohnte, und diesmal war es eine so
starke Warnung vor den Experimenten, denen
ich als Zuschauer beigewohnt hatte, daß ich, zum
Erstaunen der früheren Freunde, plötzlich die
Beziehungen zu jenen Spiritisten abbrach.
ob ich verwesende Leichname liebkost hätte, und
nichts in der Welt hätte mich je wieder zu den Sit‐
zungen bewegen können.
griffe klarer geworden, zu denen mir «Thomas a
Kempis», mein einziges mystisches Lehrbuch,
noch nicht die nötige Aufklärung gab.
vollkommenste Einweihungs-Rituale der Welt
darstellt, wußte ich damals noch nicht, trotzdem
ich an seiner Hand in die tiefsten Mysterien nach
und nach geistig eingeführt wurde. ‒
denken: «Ihr habt die Schlüssel des Himmel‐
reichs, aber Ihr gehet nicht hinein, und denen,
die hineinwollen, wehret ihr!») ‒
.So vergingen weitere Jahre, bis ich eines Tages
unter Umständen, die auch einem mehr myste‐
riös veranlagten Gemüt, als mir, genügend «my‐
stisch» erschienen wären, aufs neue mit jenem
alten Manne meiner Kinderzeit Bekanntschaft
machte. Diesmal auf eine wesentlich andere
Art. ‒ ‒
.Briefe, die ich in jener Zeit an eine liebe Seele
richtete, erfüllten die Leser mit unsagbarer Angst,
und nur die nüchterne Erwägung, daß dieser
«Wahnsinn» denn doch zu viel «Methode» habe,
verscheuchten den aufkeimenden Glauben, es
könne sich um eine geistige Erkrankung handeln.
.Wenig später wurden meine Beziehungen zu
dem «alten Mann», oder meinem Guru, denn das
war er, wie der etwas erfahrenere Leser leicht
längst raten konnte, völlig regelmäßig.
.Die letzte Spirale der Chelaschaft hatte begon‐
nen. ‒
.Im ägäischen Meer, auf einer weltabgeschiede‐
nen Insel, sollte sie ihr Ziel erreichen. ‒ ‒ ‒ ‒
unter Umständen, die auch einem mehr myste‐
riös veranlagten Gemüt, als mir, genügend «my‐
stisch» erschienen wären, aufs neue mit jenem
alten Manne meiner Kinderzeit Bekanntschaft
machte. Diesmal auf eine wesentlich andere
Art. ‒ ‒
richtete, erfüllten die Leser mit unsagbarer Angst,
und nur die nüchterne Erwägung, daß dieser
«Wahnsinn» denn doch zu viel «Methode» habe,
verscheuchten den aufkeimenden Glauben, es
könne sich um eine geistige Erkrankung handeln.
dem «alten Mann», oder meinem Guru, denn das
war er, wie der etwas erfahrenere Leser leicht
längst raten konnte, völlig regelmäßig.
nen. ‒
nen Insel, sollte sie ihr Ziel erreichen. ‒ ‒ ‒ ‒
FAST hört es sich heute wie ein Märchen an,
daß die großen Hotels des Berner Oberlan‐
des vor dem Kriege bis zu sechzig Prozent Deut‐
sche unter ihren Besuchern zählten. Jetzt beher‐
bergen sie der Mehrzahl nach Amerikaner und
Holländer; aber der Verdienstausfall, der ihnen
durch das Fehlen des deutschen Reisepublikums
erwächst, bleibt sehr empfindlich und ist so leicht
nicht auszugleichen. Vielleicht nirgends in der
Welt ersehnt man so sehr das Steigen der deut‐
schen Valuta. Jeder vereinzelt auftauchende
deutsche Besucher wird als Vorbote einer wieder‐
kehrenden besseren Zeit begrüßt.
.Aber ganz abgesehen von den hier berührten
Interessen der Schweizer Hotelbesitzer ist es auch
vom allgemeinen deutschen Standpunkt tief be‐
dauerlich, daß die geistigen Bande zwischen
Deutschland und der Schweiz durch die Ungunst
der Zeitumstände und die daraus für den Deut‐
schen sich ergebende Unmöglichkeit, die Schweiz
als Reiseziel zu wählen, so sehr gelockert werden.
daß die großen Hotels des Berner Oberlan‐
des vor dem Kriege bis zu sechzig Prozent Deut‐
sche unter ihren Besuchern zählten. Jetzt beher‐
bergen sie der Mehrzahl nach Amerikaner und
Holländer; aber der Verdienstausfall, der ihnen
durch das Fehlen des deutschen Reisepublikums
erwächst, bleibt sehr empfindlich und ist so leicht
nicht auszugleichen. Vielleicht nirgends in der
Welt ersehnt man so sehr das Steigen der deut‐
schen Valuta. Jeder vereinzelt auftauchende
deutsche Besucher wird als Vorbote einer wieder‐
kehrenden besseren Zeit begrüßt.
Interessen der Schweizer Hotelbesitzer ist es auch
vom allgemeinen deutschen Standpunkt tief be‐
dauerlich, daß die geistigen Bande zwischen
Deutschland und der Schweiz durch die Ungunst
der Zeitumstände und die daraus für den Deut‐
schen sich ergebende Unmöglichkeit, die Schweiz
als Reiseziel zu wählen, so sehr gelockert werden.
.Zwar ist entschieden die Beliebtheit des deut‐
schen Reisenden gerade durch seine Seltenheit
außerordentlich gewachsen, während anderer‐
seits mancher Schweizer, der früher im eigenen
Lande geblieben wäre, durch die für ihn so gün‐
stigen Geldverhältnisse angelockt, heute nach
Deutschland fährt und meist weit bessere Ein‐
drücke mit nach Hause nimmt, als er vorher er‐
wartet hatte. Alles das aber kann nicht die stete
nahe Berührung ersetzen, die durch den frühe‐
ren deutschen Reiseverkehr in der Schweiz gege‐
ben war.
.Und wieviel leuchtende Erinnerung lebt in un‐
seren Herzen auf, wenn die Namen der majestäti‐
schen Alpengipfel der Schweiz, der Paßüber‐
gänge und traulichen Täler im Gedächtnis vor‐
überziehen!
.Wie manchen deutschen Naturfreund mag zur
Sommerzeit die Sehnsucht packen, liebgewor‐
dene Stätten wieder aufzusuchen; aber wenn
nicht Wunder und Zeichen geschehen, dann wer‐
den die Schweizer Grenzen für die allermeisten
Menschen in deutschen Landen noch recht lange
Leidensjahre hindurch eine unübersteigbare chi‐
nesische Mauer bilden, die nur im Rückerinnern
an schönere Zeiten zu überfliegen ist.
schen Reisenden gerade durch seine Seltenheit
außerordentlich gewachsen, während anderer‐
seits mancher Schweizer, der früher im eigenen
Lande geblieben wäre, durch die für ihn so gün‐
stigen Geldverhältnisse angelockt, heute nach
Deutschland fährt und meist weit bessere Ein‐
drücke mit nach Hause nimmt, als er vorher er‐
wartet hatte. Alles das aber kann nicht die stete
nahe Berührung ersetzen, die durch den frühe‐
ren deutschen Reiseverkehr in der Schweiz gege‐
ben war.
seren Herzen auf, wenn die Namen der majestäti‐
schen Alpengipfel der Schweiz, der Paßüber‐
gänge und traulichen Täler im Gedächtnis vor‐
überziehen!
Sommerzeit die Sehnsucht packen, liebgewor‐
dene Stätten wieder aufzusuchen; aber wenn
nicht Wunder und Zeichen geschehen, dann wer‐
den die Schweizer Grenzen für die allermeisten
Menschen in deutschen Landen noch recht lange
Leidensjahre hindurch eine unübersteigbare chi‐
nesische Mauer bilden, die nur im Rückerinnern
an schönere Zeiten zu überfliegen ist.
.So werde sie auch hier nun in einem kleinen Er‐
innerungsbezirk einmal überflogen! Ich bin ge‐
wiß, daß mich mancher Leser, der die Orte und
Namen kennt, von denen hier die Rede ist, gerne
begleiten wird. ‒ ‒
.Nachdem wir wochenlang die Häupter der
Schneeriesen des Berner Oberlandes nur vor klar‐
blauem Himmel gesehen hatten, war offenbar der
Wetterumschlag gekommen; denn immer mehr
ballten sich schwere Wolkenmassen in stein‐
grauen Klumpen um die Berge, verdeckten bald
dieses, bald jenes Eishaupt der höchsten Gipfel,
bis sie auch die Jungfrau selbst, die noch vor einer
Stunde in all ihrer Majestät sich dem stets aufs
neue überwältigenden Blicke dargeboten hatte,
dichter und dichter umhüllten.
.Besorgt standen wir auf der breiten Terrassen‐
bastion des Regina-Hotels in Wengen und ver‐
suchten immer wieder, irgendein Anzeichen zu
entdecken, das doch auf besseres Wetter schlies‐
sen lassen könnte; denn lange schon war es ge‐
plant: ‒ morgen sollte es über die Stationen Ei‐
gergletscher, Eigerwand und Eismeer hinauf zur
derzeit höchsten Station der Jungfraubahn ge‐
hen, zum Jungfraujoch. Was hätten wir aber da‐
innerungsbezirk einmal überflogen! Ich bin ge‐
wiß, daß mich mancher Leser, der die Orte und
Namen kennt, von denen hier die Rede ist, gerne
begleiten wird. ‒ ‒
Schneeriesen des Berner Oberlandes nur vor klar‐
blauem Himmel gesehen hatten, war offenbar der
Wetterumschlag gekommen; denn immer mehr
ballten sich schwere Wolkenmassen in stein‐
grauen Klumpen um die Berge, verdeckten bald
dieses, bald jenes Eishaupt der höchsten Gipfel,
bis sie auch die Jungfrau selbst, die noch vor einer
Stunde in all ihrer Majestät sich dem stets aufs
neue überwältigenden Blicke dargeboten hatte,
dichter und dichter umhüllten.
bastion des Regina-Hotels in Wengen und ver‐
suchten immer wieder, irgendein Anzeichen zu
entdecken, das doch auf besseres Wetter schlies‐
sen lassen könnte; denn lange schon war es ge‐
plant: ‒ morgen sollte es über die Stationen Ei‐
gergletscher, Eigerwand und Eismeer hinauf zur
derzeit höchsten Station der Jungfraubahn ge‐
hen, zum Jungfraujoch. Was hätten wir aber da‐
von, in 3457 Meter Höhe zu sein, wenn man doch
droben nur im Nebel herumstapfen könnte?!
.«Sie werden morgen einen prächtigen Tag ha‐
ben», ließ sich da der Besitzer des Hotels verneh‐
men, der eben unserer besorgten Gruppe näher‐
getreten war.
.Nun, das hörte sich fast an wie Hohn und
wurde auch zuerst fast als mitleidiger Spott von
uns aufgenommen, bis wir doch merkten, daß es
dem stets nur in liebenswürdig-persönlicher
Weise um seine Gäste besorgten Hotelier gar
nicht in den Sinn gekommen wäre, uns ein wenig
zu verspotten, daß er im Gegenteil: mitfühlte, was
in uns vorging, und uns ganz ernstlich Hoffnung
geben wollte.
.Nun bin ich schon grundsätzlich mißtrauisch
gegen jede Gutwetterprophezeiung in den Ber‐
gen; aber wenn auch dieses Mißtrauen vielleicht
in vorliegendem Fall nicht ganz gerechtfertigt ge‐
wesen wäre, so setzte ich dennoch allerlei Zweifel
in die Wetterkundigkeit unseres freundlichen
Trösters, denn er war jahrelang drunten am Nil
Direktor eines Hotels in Assuan, bevor er sein
Schweizer Hotel übernahm (eines der auch vom
künstlerischen Standpunkt her vorbildlichsten
großen Hotels, die ich kenne); und Leute, die so
droben nur im Nebel herumstapfen könnte?!
ben», ließ sich da der Besitzer des Hotels verneh‐
men, der eben unserer besorgten Gruppe näher‐
getreten war.
wurde auch zuerst fast als mitleidiger Spott von
uns aufgenommen, bis wir doch merkten, daß es
dem stets nur in liebenswürdig-persönlicher
Weise um seine Gäste besorgten Hotelier gar
nicht in den Sinn gekommen wäre, uns ein wenig
zu verspotten, daß er im Gegenteil: mitfühlte, was
in uns vorging, und uns ganz ernstlich Hoffnung
geben wollte.
gegen jede Gutwetterprophezeiung in den Ber‐
gen; aber wenn auch dieses Mißtrauen vielleicht
in vorliegendem Fall nicht ganz gerechtfertigt ge‐
wesen wäre, so setzte ich dennoch allerlei Zweifel
in die Wetterkundigkeit unseres freundlichen
Trösters, denn er war jahrelang drunten am Nil
Direktor eines Hotels in Assuan, bevor er sein
Schweizer Hotel übernahm (eines der auch vom
künstlerischen Standpunkt her vorbildlichsten
großen Hotels, die ich kenne); und Leute, die so
lange unter dem ewig blauen Himmel des Südens
lebten, haben meist ihre Wetterinstinkte für un‐
sere Breiten ziemlich verloren.
.Wie sehr aber hatte ich am anderen Morgen in
Gedanken Abbitte zu leisten, als ich schon beim
ersten Augenaufschlag ‒ ich hatte absichtlich am
Abend die Vorhänge nicht vorgezogen ‒ das
durch all die Wochen her gewohnte Bild wieder
erblickte: den leuchtend blauen, gleichsam strah‐
lensprühenden Himmel, und davor das giganti‐
sche Jungfraumassiv, Gipfel und Silberhorn eben
gerade von dem ersten Licht der Morgensonne
zart übergossen!
.Ja, er kannte halt doch seine Berge und ihr
Wetter besser als wir; und es war kein bloßer fa‐
denscheiniger Trost gewesen, als er uns gestern
so selbstverständlich «gutes Wetter» verheißen
hatte!
.Es dauerte nicht lange, da trug uns die trotz frü‐
her Morgenstunde schon mit Fahrgästen voll‐
besetzte Wengernalpbahn hinauf zur kleinen
Scheidegg, dem Ausgangspunkt der Jungfrau‐
bahn.
.Die Fahrt bis Scheidegg hinauf ist schon an sich
überaus lohnend durch die stetig wechselnden
Bilder, die man beim langsamen Emporklimmen
lebten, haben meist ihre Wetterinstinkte für un‐
sere Breiten ziemlich verloren.
Gedanken Abbitte zu leisten, als ich schon beim
ersten Augenaufschlag ‒ ich hatte absichtlich am
Abend die Vorhänge nicht vorgezogen ‒ das
durch all die Wochen her gewohnte Bild wieder
erblickte: den leuchtend blauen, gleichsam strah‐
lensprühenden Himmel, und davor das giganti‐
sche Jungfraumassiv, Gipfel und Silberhorn eben
gerade von dem ersten Licht der Morgensonne
zart übergossen!
Wetter besser als wir; und es war kein bloßer fa‐
denscheiniger Trost gewesen, als er uns gestern
so selbstverständlich «gutes Wetter» verheißen
hatte!
her Morgenstunde schon mit Fahrgästen voll‐
besetzte Wengernalpbahn hinauf zur kleinen
Scheidegg, dem Ausgangspunkt der Jungfrau‐
bahn.
überaus lohnend durch die stetig wechselnden
Bilder, die man beim langsamen Emporklimmen
der elektrisch betriebenen Zahnradbahn fort und
fort zu beobachten Gelegenheit hat. Man genießt
dabei wie ein Fußgänger die allmähliche Erobe‐
rung der Höhe, nur völlig unbehindert durch die
Mühe eigenen Ersteigens. Vom bequemen Sitz
aus blickt man hinunter ins Lauterbrunnental mit
seinem Staubbachfall, dann geht's durch Tannen‐
wald immer höher hinauf zu Alpweiden, wo uns
Kuhglockengeläute melodisch umfängt und wo
«die guten großen Tiere» Segantinis nachdenk‐
lich an der Bahnrampe dem seltsamen Ungetüm
nachsehen, das da raupenartig auf die Höhe
kriecht und in seinem Innern so viel Menschen
herauftragen kann, ohne Stöhnen und Pusten,
und vor allem ‒ ohne Rauch, so daß man im offe‐
nen Aussichtswagen durch nichts gestört wird in
seinem Naturgenuß.
.Jetzt endlich ist, kurz vor Station Wengernalp ‒
dem weltbekannten, herrlichen Ausflugsziel ‒ die
Höhe fürs erste erklommen; und nun bietet sich
dem Auge ein Bergpanorama aus nächster Nähe!
Nun läßt sich förmlich jedes Steinchen der Glet‐
schermoränen schon greifen, und Jungfrau,
Mönch und Eiger liegen ausgebreitet in der gan‐
zen Erhabenheit und Größe ihrer urweltlichen
Formen vor uns! Hier auch erblicken wir nun
hoch oben das Jungfraujoch, den großen Glet‐
fort zu beobachten Gelegenheit hat. Man genießt
dabei wie ein Fußgänger die allmähliche Erobe‐
rung der Höhe, nur völlig unbehindert durch die
Mühe eigenen Ersteigens. Vom bequemen Sitz
aus blickt man hinunter ins Lauterbrunnental mit
seinem Staubbachfall, dann geht's durch Tannen‐
wald immer höher hinauf zu Alpweiden, wo uns
Kuhglockengeläute melodisch umfängt und wo
«die guten großen Tiere» Segantinis nachdenk‐
lich an der Bahnrampe dem seltsamen Ungetüm
nachsehen, das da raupenartig auf die Höhe
kriecht und in seinem Innern so viel Menschen
herauftragen kann, ohne Stöhnen und Pusten,
und vor allem ‒ ohne Rauch, so daß man im offe‐
nen Aussichtswagen durch nichts gestört wird in
seinem Naturgenuß.
dem weltbekannten, herrlichen Ausflugsziel ‒ die
Höhe fürs erste erklommen; und nun bietet sich
dem Auge ein Bergpanorama aus nächster Nähe!
Nun läßt sich förmlich jedes Steinchen der Glet‐
schermoränen schon greifen, und Jungfrau,
Mönch und Eiger liegen ausgebreitet in der gan‐
zen Erhabenheit und Größe ihrer urweltlichen
Formen vor uns! Hier auch erblicken wir nun
hoch oben das Jungfraujoch, den großen Glet‐
schersattel zwischen dem eigentlichen Jungfrau‐
gipfel und dem Mönch. Aber wer würde ahnen,
daß man auf diese unglaubliche Höhe mit einer
Bahn hinaufkommen kann?! Wo sieht man auch
nur die leisesten Spuren ihres Daseins??
.Doch wir haben nicht gar lange Zeit zu solchen
Betrachtungen; denn kaum konnten wir auch
nur das grandiose Bild des gewaltigen Bergmas‐
sivs so recht in uns aufnehmen, da sind wir auch
schon auf der kleinen Scheidegg angelangt, wo
die eleganten Salonwagen der Jungfraubahn be‐
reitstehen, uns aufzunehmen.
.«Einsteigen nach Station Eigergletscher, Eis‐
meer, Jungfraujoch!» ruft der sprachenkundige
«Interpret» des Platzes, der stets in liebenswür‐
digster Weise bereit ist, den Fremden aus allen
Nationen, die hier heraufströmen, Auskunft auf
alle Fragen zu geben. Wie eigentümlich berührt
doch das Aussprechen dieser Namen hier als
«Bahnstationen»! Man muß sich erst an den Ge‐
danken ordentlich gewöhnen, bevor es einem so
recht zu Bewußtsein kommt, daß man keinen Ju‐
les-Verne-Traum träumt, sondern daß das reale
Wirklichkeit ist!
.Eben hilft er einer alten Dame, die am Arm ih‐
rer Begleiterin langsam auf den Wagen zukam,
gipfel und dem Mönch. Aber wer würde ahnen,
daß man auf diese unglaubliche Höhe mit einer
Bahn hinaufkommen kann?! Wo sieht man auch
nur die leisesten Spuren ihres Daseins??
Betrachtungen; denn kaum konnten wir auch
nur das grandiose Bild des gewaltigen Bergmas‐
sivs so recht in uns aufnehmen, da sind wir auch
schon auf der kleinen Scheidegg angelangt, wo
die eleganten Salonwagen der Jungfraubahn be‐
reitstehen, uns aufzunehmen.
meer, Jungfraujoch!» ruft der sprachenkundige
«Interpret» des Platzes, der stets in liebenswür‐
digster Weise bereit ist, den Fremden aus allen
Nationen, die hier heraufströmen, Auskunft auf
alle Fragen zu geben. Wie eigentümlich berührt
doch das Aussprechen dieser Namen hier als
«Bahnstationen»! Man muß sich erst an den Ge‐
danken ordentlich gewöhnen, bevor es einem so
recht zu Bewußtsein kommt, daß man keinen Ju‐
les-Verne-Traum träumt, sondern daß das reale
Wirklichkeit ist!
rer Begleiterin langsam auf den Wagen zukam,
flink und behutsam beim Einsteigen, und ‒ in die‐
sem Moment erst empfinden wir völlig die Größe
der Idee Guyer-Zellers, des geistigen Urhebers
und Erbauers der Jungfraubahn, empfinden, was
er allen denen geben wollte und mit aller Zähig‐
keit seines unbeugsamen Willens schließlich er‐
kämpfte, die wohl die unendliche Majestät der
Bergwelt ahnend empfinden konnten, aber nie‐
mals imstande gewesen wären, die Höhen des
ewigen Eises selbst zu ersteigen...
.Während wir aber noch in derartigen Empfin‐
dungen versunken, dem bedeutenden Tatmen‐
schen, der diese Bahn erstehen ließ, unsern Dan‐
kesgruß über sein Grab hin senden, hat sich fast
unmerklich unser kleiner elektrischer Zug in Be‐
wegung gesetzt. Tief unter uns sehen wir schon
wieder die Wengernalpbahn, die uns heraufge‐
tragen hatte, nach Grindelwald hinunterkrie‐
chen; dann geht's bei uns durch einen kleinen
Vortunnel, und schon haben wir die Station Ei‐
gergletscher erreicht.
.Von Wengen aus zu Fuß, oder von der kleinen
Scheidegg her, waren wir schon öfters hier, haben
den Gletscher bis weithinauf durchquert, sind in
seine phantastischen Spalten hinuntergestiegen
und ließen die Kinder auf dem Schneefeld beim
sem Moment erst empfinden wir völlig die Größe
der Idee Guyer-Zellers, des geistigen Urhebers
und Erbauers der Jungfraubahn, empfinden, was
er allen denen geben wollte und mit aller Zähig‐
keit seines unbeugsamen Willens schließlich er‐
kämpfte, die wohl die unendliche Majestät der
Bergwelt ahnend empfinden konnten, aber nie‐
mals imstande gewesen wären, die Höhen des
ewigen Eises selbst zu ersteigen...
dungen versunken, dem bedeutenden Tatmen‐
schen, der diese Bahn erstehen ließ, unsern Dan‐
kesgruß über sein Grab hin senden, hat sich fast
unmerklich unser kleiner elektrischer Zug in Be‐
wegung gesetzt. Tief unter uns sehen wir schon
wieder die Wengernalpbahn, die uns heraufge‐
tragen hatte, nach Grindelwald hinunterkrie‐
chen; dann geht's bei uns durch einen kleinen
Vortunnel, und schon haben wir die Station Ei‐
gergletscher erreicht.
Scheidegg her, waren wir schon öfters hier, haben
den Gletscher bis weithinauf durchquert, sind in
seine phantastischen Spalten hinuntergestiegen
und ließen die Kinder auf dem Schneefeld beim
Gletscher in der Julihitze auf dem großen Hör‐
nerschlitten rodeln.
.Auch die grünsmaragdene Eishöhle, die man,
da der Gletscher stets wandert, alljährlich aufs
neue in seine Flanken bohrt, haben wir natürlich
bewundert. Der Gletscher ist uns so schon richtig
lieb und vertraut geworden und hat unvergeß‐
liche Erinnerungsbilder der Seele eingeprägt.
.Wie oft sahen wir auch schon die braunpolier‐
ten, vornehmen Wagen der Jungfraubahn gleich
hinter der Station durch die dunkle Höhlung in
den Felsen des Eiger verschwinden!
.Jetzt fährt auch unser Zug, prächtig elektrisch
beleuchtet, in die Finsternis des Berginnern hin‐
ein. (Von hier aus braucht er mit allen Aufenthal‐
ten nicht mehr ganz eine Stunde, um sein höch‐
stes Ziel zu erreichen, und überwindet dabei eine
Steigung von 1127 Meter, denn auf 2330 Meter
Höhe waren wir schon beim Eigergletscher ange‐
langt.) Nach einigem Fahren gewahren wir plötz‐
lich eindringendes Tageslicht in der Ferne des
Tunnels. Noch wenige Minuten, und der Zug
hält. «Station Eigerwand!» Ein kurzer Aufenthalt
ermöglicht es allen Reisenden auszusteigen, und
durch den Stollen, den man in die Felsen
sprengte, bis zum Aussichtspunkt zu gelangen,
nerschlitten rodeln.
da der Gletscher stets wandert, alljährlich aufs
neue in seine Flanken bohrt, haben wir natürlich
bewundert. Der Gletscher ist uns so schon richtig
lieb und vertraut geworden und hat unvergeß‐
liche Erinnerungsbilder der Seele eingeprägt.
ten, vornehmen Wagen der Jungfraubahn gleich
hinter der Station durch die dunkle Höhlung in
den Felsen des Eiger verschwinden!
beleuchtet, in die Finsternis des Berginnern hin‐
ein. (Von hier aus braucht er mit allen Aufenthal‐
ten nicht mehr ganz eine Stunde, um sein höch‐
stes Ziel zu erreichen, und überwindet dabei eine
Steigung von 1127 Meter, denn auf 2330 Meter
Höhe waren wir schon beim Eigergletscher ange‐
langt.) Nach einigem Fahren gewahren wir plötz‐
lich eindringendes Tageslicht in der Ferne des
Tunnels. Noch wenige Minuten, und der Zug
hält. «Station Eigerwand!» Ein kurzer Aufenthalt
ermöglicht es allen Reisenden auszusteigen, und
durch den Stollen, den man in die Felsen
sprengte, bis zum Aussichtspunkt zu gelangen,
von wo aus man das Tal von Grindelwald und da‐
hinter die weiten Bergketten bis fast ins Vorland
hinaus überblickt. Die Aussicht ist bestrickend,
aber dennoch trennt man sich bald von ihr, denn
noch gibt es hier keine Gletscher und ewige
Schneefirnen.
.Wieder im fahrenden Zug, wird nun mit Span‐
nung die Station Eismeer erwartet und ‒ die ver‐
wegenste Erwartung wird nicht enttäuscht, als wir
schließlich in diesem respektablen Bahnhof im
Innern des Urgesteins der Erde anlangen.
.Die Bahnstrecke hatte von Station Eigerwand
aus eine Biegung gemacht, und wir sind nun hoch
oben im Innern des Bergmassivs wieder ans Licht
gekommen, mitten in einer titanisch aufgebäum‐
ten Gletscherwelt mit haushohen Eisblöcken und
unergründlichen Spalten; und dahinter ragt wie‐
der mächtiges Felsengebirge bis zu den Gipfeln
des Schreckhorns, des Finsteraarhorns und vieler
anderer ferner Spitzen. Der Eindruck ist so uner‐
hört großartig, daß man lange braucht, seiner
Herr zu werden.
.Erst, als nach längerer staunender Bewunde‐
rung das Auge zu ermüden anfängt, empfinden
wir es doch recht angenehm, hier im Erdinnern in
einer eleganten Restauration auch unserer Leib‐
hinter die weiten Bergketten bis fast ins Vorland
hinaus überblickt. Die Aussicht ist bestrickend,
aber dennoch trennt man sich bald von ihr, denn
noch gibt es hier keine Gletscher und ewige
Schneefirnen.
nung die Station Eismeer erwartet und ‒ die ver‐
wegenste Erwartung wird nicht enttäuscht, als wir
schließlich in diesem respektablen Bahnhof im
Innern des Urgesteins der Erde anlangen.
aus eine Biegung gemacht, und wir sind nun hoch
oben im Innern des Bergmassivs wieder ans Licht
gekommen, mitten in einer titanisch aufgebäum‐
ten Gletscherwelt mit haushohen Eisblöcken und
unergründlichen Spalten; und dahinter ragt wie‐
der mächtiges Felsengebirge bis zu den Gipfeln
des Schreckhorns, des Finsteraarhorns und vieler
anderer ferner Spitzen. Der Eindruck ist so uner‐
hört großartig, daß man lange braucht, seiner
Herr zu werden.
rung das Auge zu ermüden anfängt, empfinden
wir es doch recht angenehm, hier im Erdinnern in
einer eleganten Restauration auch unserer Leib‐
lichkeit einige Stärkung zufügen zu können;
denn hier ist Wagenwechsel, und der Aufenthalt
genügt, um Seele und Leib zu ihrem Rechte ge‐
langen zu lassen. Eines der Sprüchlein in Schwei‐
zer Mundart, die mir rings an den Wänden der
äußerst geschmackvollen Restaurationsräume
auffielen, möge hier seine Stätte finden, da es mir
eine sehr beherzigenswerte Weisheit zu enthalten
scheint. Es besagt:
.«Dä hät am meiste vo sim Gält,
.Wo öppis g'seht vo dr schöne Wält!»
.Wirklich, man kann dem Spruchdichter nur
recht geben, besonders hier, wo man so Grandio‐
ses «vo dr schöne Wält» zu sehen bekommt!
.Das gilt natürlich noch weit mehr von der bald
darauf erreichten, derzeit höchsten Station der
Jungfraubahn ‒ dem Jungfraujoch.
.Wer jedoch hier heraufkommt und nur in
Sorge ist, ob er hier oben nicht etwa «verhungern»
müsse, dem sei zum Troste gesagt, daß er hier al‐
les vorfindet, was Küche und Keller einer ganz
erstklassigen großstädtischen Hotelrestauration
zu bieten haben. Und das in einer Höhe von 3457
Metern über dem Meer! Der tüchtige Wirt gehört
zu jenen Originalen, denen man schließlich auch
denn hier ist Wagenwechsel, und der Aufenthalt
genügt, um Seele und Leib zu ihrem Rechte ge‐
langen zu lassen. Eines der Sprüchlein in Schwei‐
zer Mundart, die mir rings an den Wänden der
äußerst geschmackvollen Restaurationsräume
auffielen, möge hier seine Stätte finden, da es mir
eine sehr beherzigenswerte Weisheit zu enthalten
scheint. Es besagt:
.Wo öppis g'seht vo dr schöne Wält!»
recht geben, besonders hier, wo man so Grandio‐
ses «vo dr schöne Wält» zu sehen bekommt!
darauf erreichten, derzeit höchsten Station der
Jungfraubahn ‒ dem Jungfraujoch.
Sorge ist, ob er hier oben nicht etwa «verhungern»
müsse, dem sei zum Troste gesagt, daß er hier al‐
les vorfindet, was Küche und Keller einer ganz
erstklassigen großstädtischen Hotelrestauration
zu bieten haben. Und das in einer Höhe von 3457
Metern über dem Meer! Der tüchtige Wirt gehört
zu jenen Originalen, denen man schließlich auch
eine gewisse Rauhbeinigkeit verzeiht, weil man so
gut bei ihnen aufgehoben ist.
.Ich sprach hier zuerst von den leiblichen Ge‐
nüssen, weil der Weg von der Station im Innern
des Berges zum Tageslicht und zum eigentlichen
Joch, durch das heimelige und wieder überaus
geschmackvolle Restaurant führt.
.Schon auf der Terrasse des Restaurants ist man
mitten in einer wahren Wunderwelt. Unter uns
der riesenhafte Aletschgletscher, auf dem alljähr‐
lich im Juli das berühmte «Jungfrau-Ski-Rennen»
stattfindet, gegenüber aber, in erhabener Maje‐
stät, der eigentliche Gipfel der «Königin der Al‐
pen»!
.Das Auge ist zuerst so geblendet von der fast un‐
wirklichen Weiße des Schnees, von all der strah‐
lenden Helligkeit, daß man gerne die Schnee‐
brille anlegt, oder wenn man noch keine besitzt,
sich eine hier oben noch kauft.
.Der ganz unbeschreibliche Eindruck steigert
sich noch ins völlig Märchenhafte, wenn man
dann heraustritt und mit wenig Schritten über
den Schnee, droben am Joch selbst mit seiner un‐
vergleichlichen Aussicht, angelangt ist! Weder
Wort noch Bild können hier das Wesentliche der
Empfindung zum Ausdruck bringen, die jeden
gut bei ihnen aufgehoben ist.
nüssen, weil der Weg von der Station im Innern
des Berges zum Tageslicht und zum eigentlichen
Joch, durch das heimelige und wieder überaus
geschmackvolle Restaurant führt.
mitten in einer wahren Wunderwelt. Unter uns
der riesenhafte Aletschgletscher, auf dem alljähr‐
lich im Juli das berühmte «Jungfrau-Ski-Rennen»
stattfindet, gegenüber aber, in erhabener Maje‐
stät, der eigentliche Gipfel der «Königin der Al‐
pen»!
wirklichen Weiße des Schnees, von all der strah‐
lenden Helligkeit, daß man gerne die Schnee‐
brille anlegt, oder wenn man noch keine besitzt,
sich eine hier oben noch kauft.
sich noch ins völlig Märchenhafte, wenn man
dann heraustritt und mit wenig Schritten über
den Schnee, droben am Joch selbst mit seiner un‐
vergleichlichen Aussicht, angelangt ist! Weder
Wort noch Bild können hier das Wesentliche der
Empfindung zum Ausdruck bringen, die jeden
fühlenden Menschen ergreift, der, so fast un‐
vermittelt auf dieses ragende Gletscherplateau
emporgehoben, nun mit allen Sinnen aufzuneh‐
men sucht, was ihn umgibt...
.Tausende bringt die Jungfraubahn alljährlich
hier herauf, aber es dürfte nicht einen geben, der
hier nicht in stiller Ergriffenheit verstummen
müßte, der nicht auf dieser Empore des Tempels
der Allnatur von Andacht ergriffen würde und
Höheres auch in sich selbst erwachen fühlte, als
ihm jemals im Leben des Alltags, drunten in der
Ebene, zu Bewußtsein gekommen war.
.Wer solches seinen Mitmenschen zu verschaf‐
fen wußte, der hat wahrlich den Dank der Nach‐
welt reichlich verdient! Sein schönstes Denkmal
aber bleibt sein Werk, dieses Meisterwerk, das un‐
zählige Gehirne in seinen Dienst spannte, die alle
nur durch die Kraft der Idee eines einzelnen an‐
geregt wurden, dem Werke ihr Bestes zu geben.
.Der Mann aber, aus dessen Geist heraus die
Idee einer Jungfraubahn Gestalt gewann, der
Schweizer Guyer-Zeller, hat niemals selbst diese
Firnenhöhen betreten. Er starb, als er gerade
noch kurz vorher durch den Draht die Nachricht
erhalten hatte, daß der Durchbruch bei Station
Eigerwand geglückt war.
vermittelt auf dieses ragende Gletscherplateau
emporgehoben, nun mit allen Sinnen aufzuneh‐
men sucht, was ihn umgibt...
hier herauf, aber es dürfte nicht einen geben, der
hier nicht in stiller Ergriffenheit verstummen
müßte, der nicht auf dieser Empore des Tempels
der Allnatur von Andacht ergriffen würde und
Höheres auch in sich selbst erwachen fühlte, als
ihm jemals im Leben des Alltags, drunten in der
Ebene, zu Bewußtsein gekommen war.
fen wußte, der hat wahrlich den Dank der Nach‐
welt reichlich verdient! Sein schönstes Denkmal
aber bleibt sein Werk, dieses Meisterwerk, das un‐
zählige Gehirne in seinen Dienst spannte, die alle
nur durch die Kraft der Idee eines einzelnen an‐
geregt wurden, dem Werke ihr Bestes zu geben.
Idee einer Jungfraubahn Gestalt gewann, der
Schweizer Guyer-Zeller, hat niemals selbst diese
Firnenhöhen betreten. Er starb, als er gerade
noch kurz vorher durch den Draht die Nachricht
erhalten hatte, daß der Durchbruch bei Station
Eigerwand geglückt war.
Anm.: 1925 kam Bô Yin Râ nach Massagno bei Lugano. Die 00
beiden Fotos von Lugano (aufgenommen um !1914! in einer 00
unglaublichen Qualität von Prokudin-Gorsky und bearbei‐ 00
tet von Jan Bielawski) sollen einen Eindruck der ge‐ 00
priesenen Landschaft vermitteln und sind im Buch nicht 00
enthalten:
Lugano1/ Lugano2
beiden Fotos von Lugano (aufgenommen um !1914! in einer 00
unglaublichen Qualität von Prokudin-Gorsky und bearbei‐ 00
tet von Jan Bielawski) sollen einen Eindruck der ge‐ 00
priesenen Landschaft vermitteln und sind im Buch nicht 00
enthalten:
Lugano1/ Lugano2
GESEGNET ist dieses südliche Bergland mit
seinen Seen, im Verbande der helvetischen
Republik, gesegnet sind seine Rebengelände und
Kastanienhaine, gesegnet seine malerischen
Bergdörfer und heiteren kleinen Städte, gesegnet
vor allem seine Menschen!
.Diese Nachkommen der alten Etrusker haben
bis auf den heutigen Tag noch Eigenschaften be‐
wahrt, die man weiter südlich nicht in diesem
Maße findet: sie wirken heute noch so, wie wir die
Menschen der Antike uns vorstellen, man findet
bei ihnen eine Tatkraft und Energie, eine kluge,
würdevolle Besonnenheit, eine Ehrlichkeit und
Rechtlichkeit, die dieses italische Schweizervolk
uns bald von Herzen lieb gewinnen lassen. Auch
innerhalb des Schweizer Staatsverbandes hat der
Kanton Tessin es verstanden, sich immer mehr
hohe Achtung und Sympathie zu erwerben, und
was die tüchtige Art des Tessiners zu leisten ver‐
mag, das zeigten und zeigen noch zur Stunde so
seinen Seen, im Verbande der helvetischen
Republik, gesegnet sind seine Rebengelände und
Kastanienhaine, gesegnet seine malerischen
Bergdörfer und heiteren kleinen Städte, gesegnet
vor allem seine Menschen!
bis auf den heutigen Tag noch Eigenschaften be‐
wahrt, die man weiter südlich nicht in diesem
Maße findet: sie wirken heute noch so, wie wir die
Menschen der Antike uns vorstellen, man findet
bei ihnen eine Tatkraft und Energie, eine kluge,
würdevolle Besonnenheit, eine Ehrlichkeit und
Rechtlichkeit, die dieses italische Schweizervolk
uns bald von Herzen lieb gewinnen lassen. Auch
innerhalb des Schweizer Staatsverbandes hat der
Kanton Tessin es verstanden, sich immer mehr
hohe Achtung und Sympathie zu erwerben, und
was die tüchtige Art des Tessiners zu leisten ver‐
mag, das zeigten und zeigen noch zur Stunde so
manche Männer in hohen Ämtern der Zentral‐
regierung der Schweiz, Männer, deren Namen
weit über ihr engeres und weiteres Heimatland
hinaus allüberall guten Klang haben.
.Es ist ein beglückendes Gefühl der Geborgen‐
heit hier um den Fremden, mag er auch durch die
einsamsten Täler und Schluchten wandern. Er
weiß, daß er nur guten Menschen begegnen
kann, und in dem entlegensten Albergo, das ihm
des Abends Rast gewährt, braucht er seine Türe
nicht zu verschließen.
.In solchem Lande, das alle Reize des Südens
mit aller Schönheit der Bergnatur vereint, wo
Licht und Wärme selbst noch des Winters rauhe
Kraft zu bändigen vermögen, da läßt es sich gut
sein, besonders für den, der auch andere Art und
Sitte ehrt und schätzt, der ein Land und seine Be‐
wohner als organische Einheit empfindet, der
diese Einheit mit zu erleben versucht und das
herzliche Gastrecht vollauf zu würdigen weiß, das
man ihm, dem Fremden, allerorten zugesteht.
.Ein Paradies ist dieses Land! Südlich genug, um
der belebenden Kraft der südlichen Sonne reich‐
lich teilhaftig zu werden, und doch nicht ihrem
sengenden Brande ausgesetzt, ‒ erfrischt stets
durch die Nähe der Berge mit ihrer ewigen Fir‐
regierung der Schweiz, Männer, deren Namen
weit über ihr engeres und weiteres Heimatland
hinaus allüberall guten Klang haben.
heit hier um den Fremden, mag er auch durch die
einsamsten Täler und Schluchten wandern. Er
weiß, daß er nur guten Menschen begegnen
kann, und in dem entlegensten Albergo, das ihm
des Abends Rast gewährt, braucht er seine Türe
nicht zu verschließen.
mit aller Schönheit der Bergnatur vereint, wo
Licht und Wärme selbst noch des Winters rauhe
Kraft zu bändigen vermögen, da läßt es sich gut
sein, besonders für den, der auch andere Art und
Sitte ehrt und schätzt, der ein Land und seine Be‐
wohner als organische Einheit empfindet, der
diese Einheit mit zu erleben versucht und das
herzliche Gastrecht vollauf zu würdigen weiß, das
man ihm, dem Fremden, allerorten zugesteht.
der belebenden Kraft der südlichen Sonne reich‐
lich teilhaftig zu werden, und doch nicht ihrem
sengenden Brande ausgesetzt, ‒ erfrischt stets
durch die Nähe der Berge mit ihrer ewigen Fir‐
nenwelt, und doch nie von ihren rauhen Stürmen
umtost.
.Während nördlich vom St. Gotthard bereits die
feuchten Nebel über den Tälern nördlicher Nie‐
derung lagern, während der Herbstwind die letz‐
ten vergilbten Blätter von den kahlen Bäumen
schüttelt, prangt hier im Süden der Alpen Busch‐
werk und Baum noch in vollem Grün, und die im‐
mergrünen Pflanzen, die im Norden nur in Kü‐
beln und Töpfen gezogen werden, überwintern
hier im Freien und erreichen dabei eine Größe,
die sie eben nur in ihrer Heimat haben können.
.Überall zwischen dem Laubwerk und den Blu‐
men leuchten heitere südliche Villen hervor und
aus jedem Bergdorf grüßt uns der schlanke Cam‐
panile als Zeuge alter hoher Kultur.
.Wir stehen oben auf dem Monte San Salvatore
bei Lugano und genießen in heller Freude den
wundersamen Ausblick über dieses wahrhaft ge‐
segnete Land. Tief unter uns breiten sich die ural‐
ten Wasser des Ceresio, des Lago di Lugano, in ih‐
ren mannigfach geschlungenen Buchten, und am
Fuße des Berges lagert an der smaragdenen Flut
die ausgedehnte Stadt, deren Namen der See in
heutigen Tagen trägt, in der heiteren Vornehm‐
heit ihrer leuchtenden Paläste, Villen und moder‐
umtost.
feuchten Nebel über den Tälern nördlicher Nie‐
derung lagern, während der Herbstwind die letz‐
ten vergilbten Blätter von den kahlen Bäumen
schüttelt, prangt hier im Süden der Alpen Busch‐
werk und Baum noch in vollem Grün, und die im‐
mergrünen Pflanzen, die im Norden nur in Kü‐
beln und Töpfen gezogen werden, überwintern
hier im Freien und erreichen dabei eine Größe,
die sie eben nur in ihrer Heimat haben können.
men leuchten heitere südliche Villen hervor und
aus jedem Bergdorf grüßt uns der schlanke Cam‐
panile als Zeuge alter hoher Kultur.
bei Lugano und genießen in heller Freude den
wundersamen Ausblick über dieses wahrhaft ge‐
segnete Land. Tief unter uns breiten sich die ural‐
ten Wasser des Ceresio, des Lago di Lugano, in ih‐
ren mannigfach geschlungenen Buchten, und am
Fuße des Berges lagert an der smaragdenen Flut
die ausgedehnte Stadt, deren Namen der See in
heutigen Tagen trägt, in der heiteren Vornehm‐
heit ihrer leuchtenden Paläste, Villen und moder‐
nen Hotelbauten aus dem Grün der Palmen und
dem Dunkel der Zypressen, wie die kostbare Fas‐
sung eines Edelsteins.
.Drüben am anderen Ende der Stadt erhebt
sich, wie ihr zweiter Beschützer, der Monte Bré
aus den Fluten, von Rebenhängen bedeckt, aus
denen die hellen Villen strahlen. Dort liegt der
prächtige Villenort Castagnola mit seinen Kasta‐
nienhainen, die ihm den Namen gaben, mit sei‐
nem alten Kirchlein und seinem unvergleichlich
schön gelegenen Friedhof; weiter entfernt liegt
Gandria, malerisch aus dem See heraufgebaut,
und in noch weiterer Ferne erblickt man die
Grenzorte Italiens, dem der See sich in langge‐
streckter Bucht verbindet.
.Am gegenüberliegenden Ufer aber erhebt sich
das mächtige Bergmassiv des Monte Generoso,
von dessen Gipfel aus man die ganze lombardi‐
sche Ebene bis nach Mailand hin überblicken
kann.
.Wir wenden den Blick, und über den Gefilden
des Lago Maggiore gewahren wir nun ein Alpen‐
panorama von unbeschreiblichem Reiz. Vom
Monte Rosa bis zu den Aletschfirnen drängt sich
Gipfel an Gipfel und noch weiter im Norden setzt
sich der Kranz der Schneehäupter fort, wie eine
dem Dunkel der Zypressen, wie die kostbare Fas‐
sung eines Edelsteins.
sich, wie ihr zweiter Beschützer, der Monte Bré
aus den Fluten, von Rebenhängen bedeckt, aus
denen die hellen Villen strahlen. Dort liegt der
prächtige Villenort Castagnola mit seinen Kasta‐
nienhainen, die ihm den Namen gaben, mit sei‐
nem alten Kirchlein und seinem unvergleichlich
schön gelegenen Friedhof; weiter entfernt liegt
Gandria, malerisch aus dem See heraufgebaut,
und in noch weiterer Ferne erblickt man die
Grenzorte Italiens, dem der See sich in langge‐
streckter Bucht verbindet.
das mächtige Bergmassiv des Monte Generoso,
von dessen Gipfel aus man die ganze lombardi‐
sche Ebene bis nach Mailand hin überblicken
kann.
des Lago Maggiore gewahren wir nun ein Alpen‐
panorama von unbeschreiblichem Reiz. Vom
Monte Rosa bis zu den Aletschfirnen drängt sich
Gipfel an Gipfel und noch weiter im Norden setzt
sich der Kranz der Schneehäupter fort, wie eine
weiße Zinnenmauer, die den immergrünen Kan‐
ton Tessin umschließt. Es ist fast zuviel des Schö‐
nen für das Auge, und immer wieder mühen wir
uns, den ausgebreiteten Reichtum zu fassen.
.Hier oben stand, nach manchen Funden zu
urteilen, einst ein altes Druidenheiligtum, und
mancher andere Mysterienkult mag hier seine
heilige Stätte gefunden haben, bevor ein christ‐
liches Sanktuarium sich auf dem Bergesgipfel er‐
hob.
.Die Alten wußten wahrlich ihre geweihten Stät‐
ten stets an Punkte zu legen, die schon von der
Natur dafür bestimmt zu sein schienen, und ob
wir nun auf den Hängen von Delphi stehen, oder
hier auf dem San Salvatore; ‒ wir empfinden in
gleicher Weise ein geheimnisvolles fluidisches Et‐
was an allen Orten, die dem Altertum heilig wa‐
ren, oft ohne vorher zu wissen, daß da ein Heilig‐
tum stand. ‒ ‒ ‒
.Noch lange saß ich am Abend im südlich tag‐
klaren Mondlicht auf meinem Balkon im Hotel
Villa Castagnola und blickte über die Silhouetten
des Parkes zu meinen Füßen hinüber über den
See, stets magnetisch angezogen von den Formen
des heiligen Berges, der, jetzt dem auferstande‐
ton Tessin umschließt. Es ist fast zuviel des Schö‐
nen für das Auge, und immer wieder mühen wir
uns, den ausgebreiteten Reichtum zu fassen.
urteilen, einst ein altes Druidenheiligtum, und
mancher andere Mysterienkult mag hier seine
heilige Stätte gefunden haben, bevor ein christ‐
liches Sanktuarium sich auf dem Bergesgipfel er‐
hob.
ten stets an Punkte zu legen, die schon von der
Natur dafür bestimmt zu sein schienen, und ob
wir nun auf den Hängen von Delphi stehen, oder
hier auf dem San Salvatore; ‒ wir empfinden in
gleicher Weise ein geheimnisvolles fluidisches Et‐
was an allen Orten, die dem Altertum heilig wa‐
ren, oft ohne vorher zu wissen, daß da ein Heilig‐
tum stand. ‒ ‒ ‒
klaren Mondlicht auf meinem Balkon im Hotel
Villa Castagnola und blickte über die Silhouetten
des Parkes zu meinen Füßen hinüber über den
See, stets magnetisch angezogen von den Formen
des heiligen Berges, der, jetzt dem auferstande‐
nen Erlöser geweiht, einst den Namen des Son‐
nengottes Belenius trug.
.Unzählige Geschlechter sind seitdem in die
Erde versunken, die Namen der Gottheit haben
sich gewandelt, die Herzen haben dem Göttlichen
in mannigfacher Art andere Empfindungen ge‐
weiht, aber noch immer trägt der Berg sein Hei‐
ligtum, und vielleicht ist es kein Zufall, daß es
heute das Heiligtum dessen ist, von dem die heili‐
gen Bücher künden: «Sein Angesicht leuchtete
wie die Sonne und sein Gewand war weiß wie
Schnee» ‒ ‒ ‒?
.Vielleicht gibt es in unserem tiefsten Innern
doch eine Wahrheit, die kosmisch verankert ist, so
daß sie nur im Laufe der Zeiten sich stets andere
Gewänder formt, um das Urewige, im Symbol
verhüllt, der Verehrung darzustellen.
.Reiner als an anderen Orten empfindet man in
dieser heiteren Natur des Südens das Ewige, und
es wird schwer, sich an den Gedanken zu gewöh‐
nen, daß man wieder diese heiteren Gefilde ver‐
lassen soll.
.Wer aber einmal hier seelisch heimisch wurde,
auch wenn seine Wiege im kälteren Nordland
stand, den zieht es mit unwiderstehlicher Gewalt
stets wieder zurück in den Bereich der südlichen
nengottes Belenius trug.
Erde versunken, die Namen der Gottheit haben
sich gewandelt, die Herzen haben dem Göttlichen
in mannigfacher Art andere Empfindungen ge‐
weiht, aber noch immer trägt der Berg sein Hei‐
ligtum, und vielleicht ist es kein Zufall, daß es
heute das Heiligtum dessen ist, von dem die heili‐
gen Bücher künden: «Sein Angesicht leuchtete
wie die Sonne und sein Gewand war weiß wie
Schnee» ‒ ‒ ‒?
doch eine Wahrheit, die kosmisch verankert ist, so
daß sie nur im Laufe der Zeiten sich stets andere
Gewänder formt, um das Urewige, im Symbol
verhüllt, der Verehrung darzustellen.
dieser heiteren Natur des Südens das Ewige, und
es wird schwer, sich an den Gedanken zu gewöh‐
nen, daß man wieder diese heiteren Gefilde ver‐
lassen soll.
auch wenn seine Wiege im kälteren Nordland
stand, den zieht es mit unwiderstehlicher Gewalt
stets wieder zurück in den Bereich der südlichen
Berge, an diese Seegestade, mit ihren lauen Lüf‐
ten, ihren Sonnentagen, die alles im strahlenden
Lichte baden, ihren Mondscheinnächten voll von
flimmerndem Silberglanz, ‒ und mit dankerfüll‐
tem Herzen sendet er auch aus der Ferne seine
Grüße in dieses gesegnete Land.
ten, ihren Sonnentagen, die alles im strahlenden
Lichte baden, ihren Mondscheinnächten voll von
flimmerndem Silberglanz, ‒ und mit dankerfüll‐
tem Herzen sendet er auch aus der Ferne seine
Grüße in dieses gesegnete Land.
ICH weiß von einer lieben alten Schweizerfrau,
die ihr ganzes Leben hoch über einem welt‐
bekannten Tal in einem kleinen Almengütli bei
harter Arbeit verbracht hatte, und mit der man
doch die anregendsten Gespräche über viele Bü‐
cher führen konnte. Ein einziges Mal war sie in
der nächst erreichbaren Stadt gewesen. Niemals
hat sie einen Eisenbahnwagen betreten. Wie ich
vor Jahren hörte, ist die Gute hochbetagt gestor‐
ben. Zu ihren Lebzeiten aber konnte man bei ihr
nicht nur die Bibel und gute Goethe- und Schil‐
ler-Gesamtausgaben finden, sondern auch alles
von ihrem geliebten Jeremias Gotthelf, von Gott‐
fried Keller und Conrad Ferdinand Meyer. Die
ganze Bibliothek war versorgt in einem großen al‐
tertümlichen Schrank, den sie wie ihr Heiligtum
gehütet hat. Ich glaube getrost sagen zu dürfen,
daß alle Schweizer Schriftsteller sich Leser wün‐
schen würden von Art und Gehalt dieser alten
einfachen Bauersfrau, die beinahe von allen Sei‐
ten ihrer Bücher wußte, was dort zu finden war,
weil sie alles auch im Herzen trug!
die ihr ganzes Leben hoch über einem welt‐
bekannten Tal in einem kleinen Almengütli bei
harter Arbeit verbracht hatte, und mit der man
doch die anregendsten Gespräche über viele Bü‐
cher führen konnte. Ein einziges Mal war sie in
der nächst erreichbaren Stadt gewesen. Niemals
hat sie einen Eisenbahnwagen betreten. Wie ich
vor Jahren hörte, ist die Gute hochbetagt gestor‐
ben. Zu ihren Lebzeiten aber konnte man bei ihr
nicht nur die Bibel und gute Goethe- und Schil‐
ler-Gesamtausgaben finden, sondern auch alles
von ihrem geliebten Jeremias Gotthelf, von Gott‐
fried Keller und Conrad Ferdinand Meyer. Die
ganze Bibliothek war versorgt in einem großen al‐
tertümlichen Schrank, den sie wie ihr Heiligtum
gehütet hat. Ich glaube getrost sagen zu dürfen,
daß alle Schweizer Schriftsteller sich Leser wün‐
schen würden von Art und Gehalt dieser alten
einfachen Bauersfrau, die beinahe von allen Sei‐
ten ihrer Bücher wußte, was dort zu finden war,
weil sie alles auch im Herzen trug!
ENDE